Kalifat ist keine Metapher
Kalifat-Fans marschieren wieder mal in Deutschland auf. Und als im April um die Tausend Demonstrant:innen dem Aufruf von »Muslim Interaktiv«, einer Tarnorganisation der verbotenen islamistischen Gruppierung Hizb ut-Tahrir, folgend auf dem Hamburger Steindamm lautstark die Errichtung eines Kalifats forderten und gegen vermeintliche Pressezensur und Islamfeindlichkeit protestierten, war darauf Verlass, dass in den deutschen Medien diese Entwicklung relativiert werden würde. Dieses mal fiel diese Rolle Khola Maryam Hübsch zu, der Tochter von Paul-Gerhard Hadayatullah Hübsch, der zu jenen deutschen Altachtundsechzigern mit bürgerlichem-christlichem Hintergrund gehört, die im islamischen Mystizismus ihre Bestimmung fanden. Er und seine Tochter gehören der Ahmadiyya-Bewegung an.
»Kalif« und »Kalifat« seien politische Kampfbegriffe geworden, beklagte Hübsch, die als Vertreterin der muslimischen Gemeinden im hessischen Rundfunkrat sitzt, in der ARD-Talkshow »Hart aber fair«, man müsse sie aber richtig einordnen, denn es handle sich um ganz normale islamische Termini. Schließlich habe auch ihre Gemeinde einen »weltweiten Kalifen«, der sogar die »islamische Welt« und die »Großmächte« dazu ermahne, zu verhandeln, statt Krieg zu führen – Kalifat als freundliches spirituelles Management. Weiter führte sie aus, dass es auch Teil der Sharia sei, wenn jemand sich ehrenamtlich engagiere. So wie man in den vergangenen Jahren gelernt hat, dass Jihad bedeutet, seine Hausaufgaben gut zu machen, möchte man gedanklich ergänzen. Die rhetorischen Nebelkerzen des politischen Islam und seiner obskurantistischen Verteidiger hätten komödiantisches Potential, wäre die Lage nicht so ernst.
»Die größte yezidische Diaspora in Europa lebt in Deutschland, Zehn-tausende Yezid:innen sind trotz der Lage in ihrer Heimat ausreisepflichtig und ihnen droht die Abschiebung.« Die Beratungsstelle Pena-Ger
Im August dieses Jahres wird es zehn Jahre her sein, dass der »Islamische Staat« (IS) in Windeseile ganze Landesteile des Irak und Syriens übernahm, sich auf die obigen Konzepte berief und sie in Form des blutigen Genozids an den Yezid:innen (auch Eziden oder Êzîden), in die Tat umsetzte. Mindestens 5 000 wurden in seinem Herrschaftsbereich, dem sogenannten Kalifat, getötet, fast 7 000, zumeist Frauen und Kinder, versklavt, von denen bis heute 2 700 vermisst und teils im internationalen islamistischen Sklavenhandelssystem verschwunden sind. Wenn an deutschen Hochschulen derzeit von einem Genozid die Rede ist, ist nie dieser gemeint, der vielmehr immer mehr in Vergessenheit gerät, und mit ihm der Ausnahmezustand, in dem Yezid:innen bis heute in Nordsyrien und der Autonomen Region Kurdistan im Irak leben. Abschiebungen von nach Deutschland geflohenen Yezid:innen in den Irak gehören in vielen Bundesländern längst wieder zur Regel, die Lage im Irak stufen deutsche Behörden als sicher ein, die meisten Yezid:innen erhalten kein Asyl.
»Die größte yezidische Diaspora in Europa lebt in Deutschland, allerdings sind Zehntausende Yezid:innen trotz der Lage in ihrer Heimat ausreisepflichtig und ihnen droht die Abschiebung«, sagt die Organisation Pena-Ger, die bundesweit kurdischsprachige Beratung für Flüchtlinge anbietet, der Jungle World. »Die Behörden begründen das damit, dass ihnen bei der Rückkehr keine Gefahr für Leib und Leben drohen würde. Eine unmenschliche und unverantwortliche Abschiebepolitik, die selbst vor Genozidüberlebenden und -bedrohten nicht Halt macht.«
Sicher ist die Lage nirgendwo in der Region. Das ist auch eine Folge der zurückhaltenden Außenpolitik der USA, die sich seit Jahren möglichst aus dem Irak und Syrien zurückziehen wollen. Die USA und ihre Partner in der internationalen Anti-IS-Koalition haben insbesondere in der Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien (oft auch Rojava genannt), wo kurdische Milizen die schwersten Verluste im Krieg gegen den IS erlitten, einen Wust ungelöster Probleme hinterlassen.
In den Flüchtlingscamps al-Hol und al-Roj werden bis heute 52 000 Personen aus IS-Familien festgehalten, vor allem Frauen und Kinder. Einige internationale Organisationen wollen den kurdischen Gruppen an Ort und Stelle die Verantwortung für diese meist durch und durch islamistisch radikalisierten Menschen überlassen, Deradikalisierungspläne oder langfristige Konzepte dafür, was man überhaupt mit ihnen anfangen könne und solle, gibt es nicht. Experten sprechen von einer neuen Generation von IS-Kämpfern, die in den Lagern heranwächst. Fast 38 000 Insassen in den beiden Lagern sind Ausländer, die meisten aus dem Irak, circa 10 000 aus allen möglichen weiteren Ländern. Rückführungen in ihre Herkunftsstaaten laufen bis heute schleppend.
Dazu kommen mindestens 10 000 IS-Kämpfer, inhaftiert in Dutzenden Gefängnissen, die oft provisorisch in ehemaligen Schulen und ähnlichen Gebäuden eingerichtet wurden. Wie brisant die Situation ist, wurde im Januar 2022 deutlich, als im Gefängnis Ghuwayran nahe der Stadt Hasakah ein großangelegter Aufstand begann und Tausende Kämpfer der Syrian Democratic Forces (SDF) mobilisiert werden mussten, um die gefangenen IS-Kämpfer in Schach zu halten. 421 IS-Kämpfer und 121 Gefängniswärter und SDF-Kämpfer kamen dabei ums Leben. Die US-Armee leistete zwar Luftunterstützung, hielt sich aber ansonsten zurück, während die Türkei während des Aufstands sogar SDF-Stellungen in der Region bombardierte.
Die ideologische und materielle Unterstützung aus der Türkei für Jihadisten verschiedenster Couleur wird bei einem Blick auf die Infrastruktur der Lager für IS-Anhänger deutlich. Diese Zeltstädte sind sehr groß. Zwar werden sie von außen bewacht, doch was in ihnen vor sich geht, lässt sich kaum kontrollieren. Regelmäßig werden vermeintlich abtrünnige Frauen exekutiert, immer wieder werden Waffen und andere Güter hereingeschmuggelt, im Innern der Camps befinden sich geheime Tunnelanlagen, die nach außen führen. Durch diese Tunnel können Verbindungen bis weit nach Idlib im Nordwesten Syriens aufrechterhalten werden, wo türkisch unterstützte Jihadisten und die mit ihnen rivalisierende Islamistenmiliz Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) die Kontrolle ausüben.
In der Nähe von Idlib befindet sich der Grenzübergang Bab al-Hawa, der einzige offiziell von den UN freigegebene Übergang für Waren- und Hilfsgüterverkehr zwischen der Türkei und Nordsyrien. Dass just in diesem Grenzgebiet sowohl 2019 der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi als auch 2022 sein Nachfolger Abu Ibrahim al-Qurashi gefunden und getötet wurden, zeugt von der Präsenz des IS in dem mit syrischen Flüchtlingen gefüllten Islamistengebiet, das sowohl die Türkei als auch westliche Staaten unbedingt erhalten wollen, denn mehr Flüchtlinge will derzeit niemand. Ebenfalls deutlich sind die Verbindungen in die Türkei im Falle der zahlreichen Schmuggelaktionen, bei denen Gefangene aus den Lagern befreit werden und in die Türkei gelangen.
Zudem ist die militärische Präsenz des IS selbst mitnichten Vergangenheit. Mutmaßlich Hunderte IS-Schläferzellen sind bis heute in Syrien und Irak aktiv und greifen immer wieder Soldaten oder Zivilist:innen an, oftmals Bauern bei der Ernte oder Beamte an Checkpoints. Das Rojava Information Center meldet allein für März 27 Angriffe, wobei zehn kurdische Soldaten und ein Zivilist getötet worden seien. Ein IS-Angriff im Irak tötete im Mai fünf irakische Soldaten. Im yezidischen Kerngebiet, dem Sinjar-Gebirge im Irak (auf Kurdisch Şingal genannt), wo immer noch Kämpfe zwischen verschiedenen Milizen stattfinden, kommt es außerdem regelmäßig zu Luftangriffen der türkischen Armee. In diese Zustände werden Yezid:innen aus Deutschland abgeschoben.
Zehn Jahre nach dem Genozid im Sinjar-Gebirge stehen alle Zeichen auf Vergessen: Vergessen, dass Tausende yezidische Frauen noch gerettet werden müssen, dass der IS noch nicht vollständig besiegt ist und seine nächste Generation ausbildet, dass die Türkei Jihadisten unterstützt und fördert mitmischt.
Die Reaktionen auf den 7. Oktober 2023 deuten darauf hin, dass eine politische Aufarbeitung des jihadistischen Terrors gegen die Yezid:innen bis auf weiteres ausbleiben dürfte. Während am 7. Oktober die Bilder der überrannten, getöteten, verstümmelten und entführten Israelis bei IS-Opfern die Bilder des Genozids an den Yezid:innen in Erinnerung riefen, posteten Tausende die Aufnahmen der zerrissenen israelischen Zäune als Symbole einer vermeintlichen Befreiung. Als die extreme Gewalttätigkeit der Hamas nicht mehr zu leugnen war, wurden die Rufe nach »Kontextualisierung« ihrer Taten laut, und nicht wenige Linke leugnen die sexualisierte Kriegsgewalt der Hamas bis heute.
Im Online-Infokrieg, der rund um den Krieg gegen die Hamas ausgetragen wird, wächst seit Monaten die Followerschaft der islamistischen Rattenfänger von »Muslim Interaktiv« und Co., die auf Instagram und anderen Kanälen unablässig Propaganda über den Krieg im Gaza-Streifen verbreiten. Während die Online- und Talkshow-Obskuranten mit neuen Verharmlosungen der Begriffe Kalifat, Jihad und Sharia aufwarten und die offensichtlichen Zusammenhänge zwischen Sderot und Sinjar verwischen, kann man sich nur davor fürchten, wie eine derart vorbereitete Öffentlichkeit bei einer Rückkehr des IS auf die Praxis, für die er diese Begriffe gebraucht, reagieren würde.



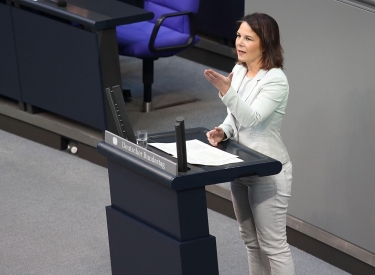



 Das ungewollte Franchise
Das ungewollte Franchise


