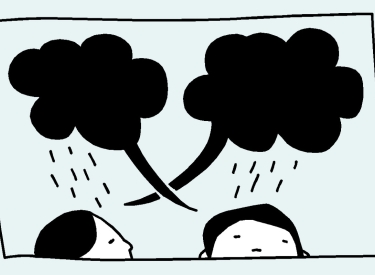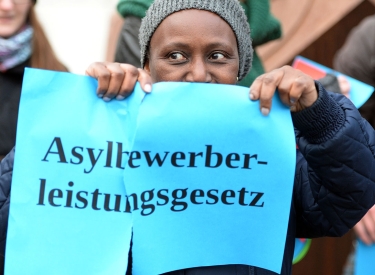»Auf Plakaten wurden ein Davidstern und das Wort ›Israel‹ zerkratzt«
Was ist passiert?
Wir haben in unserem ersten Obergeschoss die Sonderausstellung »Skandal oder Normalität?« zu antisemitischen Ereignissen nach 1945. Dort wurden Plakate zerstört. Zum einen Plakate, die sich gegen israelbezogenen Antisemitismus nach dem 7. Oktober positionieren. Auf denen wurden der abgebildete Davidstern und das Wort »Israel« zerkratzt, vermutlich mit einem Schlüssel. Bei beiden Plakaten glichen sich die zugefügten Risse. Außerdem wurde ein Plakat komplett von der Wand gerissen, das an den Terroranschlag auf das jüdische Altenheim in München 1970 erinnerte – wohlgemerkt mit einem Zitat von Charlotte Knobloch. Damals wurden sieben Holocaust-Überlebende ermordet.
Kommt so etwas öfter vor?
Wir erleben verhältnismäßig wenig Vandalismus im Vergleich etwa zu anderen Gedenkstätten, aber regelmäßig werden zum Beispiel einzelne Buchstaben oder Zahlen von der Schrifttafel entfernt.
»Die Entwicklungen vor dem 7. Oktober haben das möglich gemacht. Ich denke etwa an den Umgang mit der Documenta 15 oder Einlassungen während des ›Historikerstreits 2.0‹. Hier wurde etwas normalisiert, was jetzt Alltag geworden ist.«
Die Gedenkstätte Sachsenhausen gab kürzlich bekannt, dass sie das Gästebuch wegen antisemitischer Kommentare nicht mehr auslegt. Wie ist es bei Ihnen?
Auch in unserem Gästebuch kam es nach dem 7. Oktober zu kritischen Eintragungen. Am 16. Oktober wurde drei Mal »Free Palestine« geschrieben. In einem Eintrag wurde auch die Karte »Palästinas« gemalt, das vom Fluss bis zum Meer reichte. Israel existierte auf dieser Karte nicht. Teils antworten Besucher:innen auf Hebräisch mit »Am Israel Chai«, schreiben »Bring them home« oder ergänzen »from Hamas« unter »Free Palestine«. Es findet hier also eine richtige Auseinandersetzung statt. Die Eintragungen reagieren, denke ich, auf die genannte Sonderausstellung, die zum Beispiel auch das Schicksal eines Kollegen von Yad Vashem thematisiert, der seit dem 7. Oktober im Gaza-Streifen als Geisel sitzt. Bis Ende des Jahres war das eine Handvoll Einträge. Seit ein paar Wochen häuft sich das stark.
Wie gehen Sie damit um?
Unterschiedlich. Solange das eine lebendige Form der Auseinandersetzung ist, lassen wir das stehen. Am 16. Oktober habe ich selbst kommentiert. Wir beobachten das täglich, im Moment liegt das Buch noch aus. Aber die genannte Karte haben wir entfernt. Da ist eine Grenze überschritten.
Wird die Stimmung seit dem 7. Oktober rauer?
Positionen stehen sich unversöhnlicher gegenüber. Die Flut an Ereignissen und Übergriffen ist schon neu. Aber: Die Entwicklungen vor dem 7. Oktober haben das möglich gemacht. Ich denke etwa an den Umgang mit der Documenta 15 oder Einlassungen während des »Historikerstreits 2.0«. Hier wurde etwas normalisiert, was jetzt Alltag geworden ist.
Wie bekämpft man in einem Ort, der eine Gedenk- und Bildungsstätte für die Erinnerung an die Shoah ist, auch den gegenwärtigen Antisemitismus?
Die Sonderausstellung ist so ein Versuch. Wir nehmen uns Zeit, auf Social Media wie vor Ort, um mit Expert:innen zusammen antisemitische Vorfälle ins Bewusstsein zu rücken, die oft übersehen werden. Im Mai 2023 haben wir auch eine große Konferenz zum Antisemitismus in Kunst und Kultur ausgerichtet. Zudem haben wir eine sehr große Bibliothek mit aktueller Literatur zu Antisemitismus. Die kann jede:r für Recherchen nutzen. Das zeigt: Wir sind als Gedenk- und Bildungsstätte klar positioniert, wir engagieren uns politisch und bekämpfen damit auch gegenwärtigen Antisemitismus.


 Die Zahlen steigen
Die Zahlen steigen