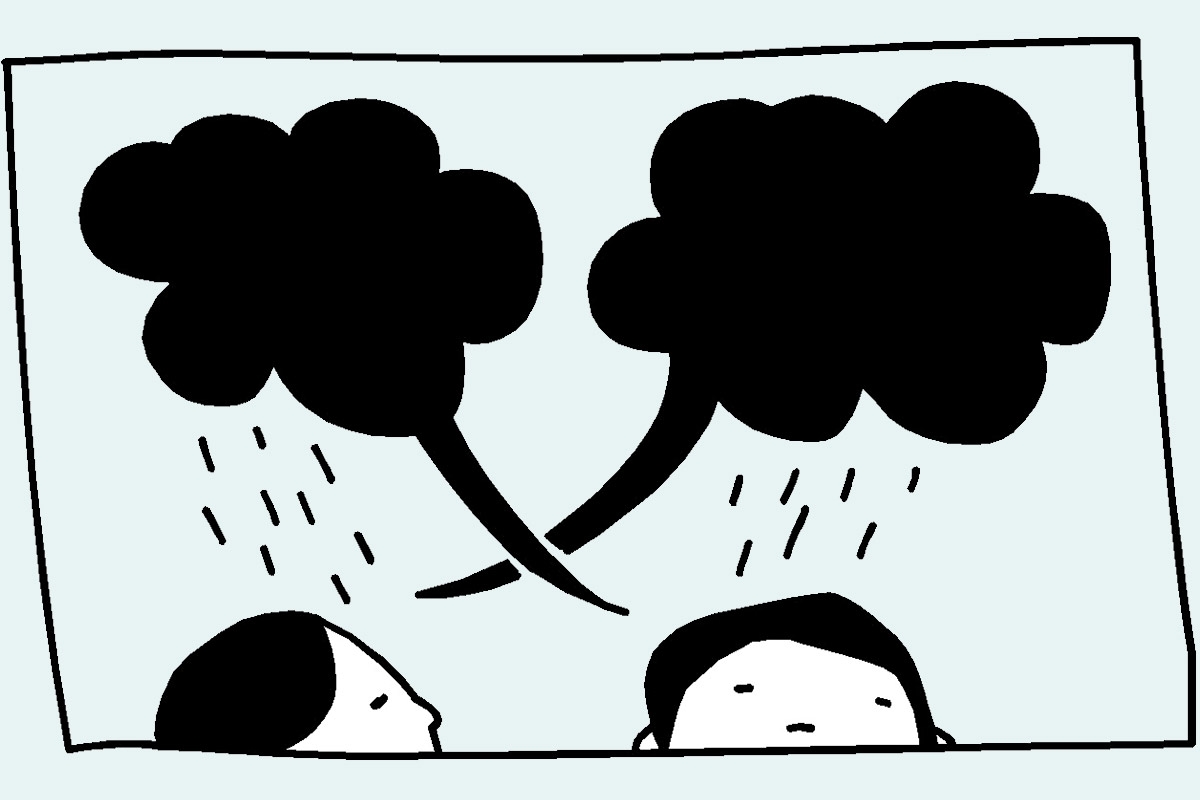»Holocaust-Relativierung ist immer ein Teil von Antisemitismus«
Was ist das Survivor Speakers Bureau?
Das Bureau ist eine neue Einrichtung der Claims Conference, die Shoah-Überlebende an Schulen, Universitäten oder ähnliche Organisationen vermittelt, wenn sie Interesse an einem Zeitzeugengespräch haben. Zum einen hilft das denen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Zum anderen gibt es aber auch den Überlebenden Sicherheit, weil wir die Vorgespräche führen und dann einschätzen können, ob die Einladenden vertrauenswürdig sind. Wir kümmern uns auch um die Nachbereitung, immerhin sprechen diese Menschen über ihr Schicksal, die Geschichte ihrer Verfolgung. Das hinterlässt Spuren.
Wen kann man durch dieses Programm treffen?
Überlebende sind alle, die in der Zeit des Nationalsozialismus Ghettos oder Konzentrationslager überlebt haben oder Opfer von antijüdischen Gesetzen wurden, etwa die Schule verlassen mussten, aber noch rechtzeitig vor den Tötungsaktionen fliehen konnten. Anfragen können aus der ganzen Welt kommen. Wir schauen dann, welche Überlebenden zum Beispiel sprachlich passen. Für ein Online-Treffen mit einer Zeitzeugin kann man sich leicht auf unserer Website registrieren.
Seit dem 7. Oktober tobt eine neue Welle des Antisemitismus. Überlebende trauen sich teils nicht mehr an Hochschulen, weil die Situation so bedrohlich ist. Ist das der Grund, warum die Treffen bei Ihnen meist digital stattfinden?
Nein. Die Idee dazu entstand im Laufe der Pandemie. Viele Überlebende können nicht mehr gut reisen, da bringt die Digitalisierung auch Chancen mit sich. Dennoch gewinnt das Programm angesichts der Ereignisse seit dem 7. Oktober zusätzlich an Aktualität. Mit dem Anstieg an Judenhass kommt auch ein Anstieg von Holocaust-Relativierung und -Leugnung. Auch gegen Desinformation und Antisemitismus kann das Programm etwas ausrichten.
Inwiefern?
Holocaust-Relativierung ist immer ein Teil von Antisemitismus. Die persönlichen Erzählungen von Überlebenden hinterlassen einen tiefen Eindruck. Damit lässt sich dann auch Antisemitismus bekämpfen. Denn der ist immer eine Form der Dehumanisierung. Aber wenn eine Person ihre sehr persönliche Geschichte erzählt, dann setzt das dieser Entmenschlichung etwas entgegen. Begegnung kann dem Hass etwas entgegensetzen. Durch die Unmittelbarkeit des Gesprächs kriegen die Erzählungen ein ganz besonderes Gewicht. Und Menschen leben durch Geschichte.
Nach dem 7. Oktober fehlte es vor allem an Mitgefühl. Laut Ihrer Website ist Ihre Idee, Hass und Intoleranz mit Mut und Mitgefühl zu begegnen. Funktioniert das?
Gute Frage. Ich denke, durch die Gespräche kann im besten Fall ein Mitgefühl geschaffen werden, das nachhallt. Darauf beruhte vielfach Holocaust Education und die war immer schon auch eine Form, Antisemitismus zu bekämpfen.
Wird das Programm gut angenommen?
Wir haben in den vergangenen Wochen schon einige Anfragen von Schulen aus ganz Deutschland bekommen. Ich bin mir sicher, dass es sich schnell herumsprechen wird, dass es jetzt unser Speakers Bureau gibt. In dieser Zeit der rasanten Verbreitung von Holocaust-Leugnung und Holocaust-Verzerrung können wir Lehrer ganz praktisch dabei unterstützen, Kontakt zu Shoah-Überlebenden aufzunehmen, um sie in ihre Schulen einzuladen, damit sie von ihrer Verfolgung in der Nazi-Zeit berichten.