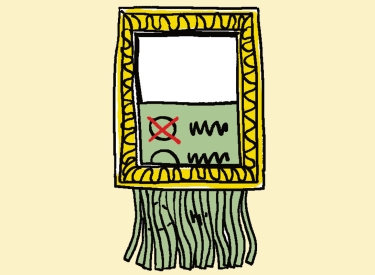Die Zukunft ist ungewiss
Die Vorbereitungen für eine Abspaltung von Sahra Wagenknecht und ihrer Anhänger:innen von der Linkspartei gewinnen an Fahrt. Inzwischen versucht der Parteivorstand die Flucht nach vorn. »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht«, hat er jetzt einstimmig beschlossen. Doch der große Befreiungsschlag ist das nicht, sondern nur die Anerkennung eines Bruchs, den die 53jährige längst de facto vollzogen hat. Auch der Appell an sie und ihre Verbündeten in der Bundestagsfraktion, es sei »ein Gebot des politischen Anstandes und der Fairness gegenüber den Mitgliedern unserer Partei, wenn diejenigen, die sich am Projekt einer konkurrierenden Partei beteiligen, konsequent sind und ihre Mandate zurückgeben«, ist kein Ausdruck von Stärke, was sich an der praktischen Konsequenzlosigkeit dieser Aufforderung zeigt.
Hintergrund des Vorstandsbeschlusses sind bekannt gewordene Abwerbeversuche in mehreren Landesverbänden. »Nunmehr erreichen uns vermehrt Informationen, dass diese Neugründung in der zweiten Jahreshälfte hier in Sachsen stattfinden soll«, hat der sächsische Landesvorstand Anfang Juni in einem Beschluss festgestellt. Für dieses »Spaltungsprojekt« würden mehr oder weniger im Geheimen »verdiente und qualifizierte Genossinnen und Genossen angesprochen«.
Von zumindest einem Fall berichten die Landesvorsitzenden in Thüringen. Der Spiegel schrieb sogar, es gebe »Screenshots von Mails und SMS aus mehreren ostdeutschen Landesverbänden«, die belegen würden, dass Kommunalpolitiker:innen direkt von Wagenknechts engerem Kreis angesprochen wurden, ob sie am Konkurrenzprojekt teilnehmen wollten. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es entsprechende Aktivitäten, bestätigte die dortige Landesvorsitzende.
Ein greifbares Resultat des Vorstandsbeschlusses ist, dass das Wagenknecht-Lager jede Zurückhaltung abgelegt hat.
Ein greifbares Resultat des Vorstandsbeschlusses ist, dass das Wagenknecht-Lager jede Zurückhaltung abgelegt hat. Mit diesem Beschluss werde »der Kurs der Parteiführung in Richtung einer bedeutungslosen Sekte noch verschärft«, twitterte Sevim Dağdelen. »Wer so einen Beschluss fasst, verdient es unterzugehen«, beschied Klaus Ernst und attestierte dem Vorstand ein »links-ökologisches Sektierertum«. Und Christian Leye schrieb: »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Bedeutung.«
Von ähnlicher Qualität waren die Wortmeldungen von Żaklin Nastić, Jessica Tatti und Alexander Ulrich. Den Vorwurf des Parteivorstands, dass es Pläne zur Gründung eines Konkurrenzprojekts gibt, bestritten die sechs Bundestagsabgeordneten nicht. Und niemand von ihnen distanzierte sich von solchen Spaltungsaktivitäten. Aber umso heftiger empörten sie sich, dass der Vorstand solch eindeutig parteischädigendes Treiben nicht mehr hinnehmen will.
Es ist ein Trennungsprozess, der sich bereits seit fünf Jahren hinzieht, nunmehr jedoch offenbar in seine Endphase eintritt. Den ersten Versuch begann Wagenknecht im September 2018 mit ihrer vermeintlichen Sammlungsbewegung »Aufstehen«. Die sollte der Ausgangspunkt für eine »populäre« Alternative zur Linkspartei sein, scheiterte jedoch nach nicht einmal einem halben Jahr krachend, nicht zuletzt am Dilettantismus ihrer Organisator:innen.
Dass die seinerzeitige Parteiführung um Katja Kipping und Bernd Riexinger es nicht gewagt hat, ihnen den Rückkehr in die Linkspartei zu verbauen, ist als ihr größtes Versagen anzusehen. Denn da war die Partei noch in einem weitaus besseren Zustand und rangierte in den Umfragen zwischen neun und elf Prozent. Die Abspaltung des Wagenknecht-Lagers hätte zwar auch damals für einige Irritationen gesorgt, wäre aber verkraftbar gewesen.
Wagenknechts Fangemeinde sei »konservativ, spießig und sieht keine Alternative zum Kapitalismus, will diese auch nicht«, sagte Thies Gleiss, ein ehemaliges Bundesvorstands-mitglied der Linkspartei.
Stattdessen schaffte es Wagenknecht, 2021 erneut von der Linkspartei für den Bundestag aufgestellt zu werden. Obwohl sie pünktlich zur Listenaufstellung mit ihrem Buch »Die Selbstgerechten« eine Generalabrechnung mit der Linken im Allgemeinen und ihrer Partei im Besonderen veröffentlicht hatte, wurde Wagenknecht zur Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen gekürt.
Dass ihr in dem Bestseller aufgestelltes »Programm für Gemeinsinn, Zusammenhalt und Wohlstand«, das sie selbst als »linkskonservativ« bezeichnete, eindeutig nicht mehr für die Linkspartei geschrieben war, scherte die Mehrheit der Delegierten im größten Landesverband nicht. Alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen. »Vermutlich möchte sie gerne noch einmal in den Bundestag gewählt werden, um dann mit ihren Getreuen etwas Neues aufzubauen«, befürchtete Thies Gleiss, damals Mitglied im Linkspartei-Bundesvorstands, in der Taz. Gleiss sollte recht behalten.
Ende April hat der Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen beschlossen, er erwarte »von allen Bundestagsabgeordneten der Linken aus NRW, dass sie in persönlichen Erklärungen und in einem gemeinsamen Beschluss allen Andeutungen und Überlegungen über die Gründung einer anderen Partei öffentlich entgegentreten«. Insbesondere von Wagenknecht verlange er »ohne Wenn und Aber ein klares Bekenntnis zu unserer Partei«. Hätte die Partei das mal früher verlangt. Jetzt ist es zu spät. Nur eine der sechs Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, die Landesvorsitzende Kathrin Vogler, zählt nicht zum Wagenknecht-Lager.
Sieben bis elf Mitglieder der insgesamt 39köpfigen Bundestagsfraktion könnten sich an einem neuen Parteiprojekt beteiligen, heißt es aus Fraktionskreisen. Für den Verlust des Fraktionsstatus der Linkspartei würden schon drei Abgänge genügen. Noch aber ist es nicht so weit. Alles hängt von Wagenknecht ab. Seit Monaten bekundet sie, sich bis Ende des Jahres entscheiden zu wollen.
In etlichen Interviews hat Wagenknecht keinen Zweifel daran gelassen, dass es sich für sie nicht mehr um eine politische, sondern ausschließlich organisatorische Frage handelt. »Die Erfahrung mit Aufstehen zeigt, wie wichtig gute Vorarbeit und ein stabiles organisatorisches Gerüst für das Gelingen eines Projekts sind«, sagte sie dem Tagesspiegel. »Solange die organisatorischen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, wäre es unseriös, irgendetwas anzukündigen«, ließ sie den Spiegel wissen. Aber sie wünsche sich, »dass die vielen Menschen, die sich heute von keiner Partei mehr vertreten fühlen, wieder ein seriöses politisches Angebot bekommen«. Wie es heißt, arbeitet derzeit ein sehr kleiner Kreis von Abgeordneten und Mitarbeitenden hinter den Kulissen fieberhaft daran.
Wagenknechts Partie wäre eine für den Wutbürger:innenstammtisch, der Klimaschutz blöd, Impfen doof, Gendern scheiße, die EU bekloppt, die USA schrecklich, Geflüchtete noch schrecklicher, Wladimir Putins Russland hingegen töfte und die deutsche Nation toll findet.
Noch hat Wagenknecht Zeit. Für eine Konkurrenzkandidatur bei der Europawahl im Juni 2024 würde eine formale Trennung Anfang kommenden Jahres reichen. Bis Anfang März muss der Wahlvorschlag beim Bundeswahlleiter eingereicht sein. Das wäre aber nur eine Zwischenetappe. Die Europawahl wäre »schon ein wichtiger Test für eine solche Formation«, sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich vor ein paar Tagen in der Internet-Talkshow »Moats auf Deutsch« seines früheren Fraktionskollegen Diether Dehm. Wenn es so komme, könne die Bundestagsfraktion der Linkspartei nicht fortbestehen. »Aber diejenigen, die möglicherweise zum Sahra-Wagenknecht-Flügel gehören, wir wären ja weiterhin im Bundestag«, sagte Ulrich. Bei einem Wahlerfolg kämen Parlamentarier:innen auf Europaebene hinzu. Da bestünden dann schon Möglichkeiten, »diese Zeitspanne zwischen Europawahl und Bundestagswahl zu überbrücken«.
Dass sich die Linkspartei in einer Existenzkrise befindet, verdankt sich nicht zuletzt ihrem jahrelangen Unvermögen, sich klar von der in trüben Gewässern fischenden Populistin und ihrem zerstörerischen Anhang zu distanzieren. Das hat viel politisches Kapital gekostet, möglicherweise zu viel. Die Wählerschaft der Linkspartei ist in den meisten Ländern und bundesweit bereits so klein, dass schon relative geringe Stimmenverluste den Weg in den Untergang bereiten könnten.
Da nützt es ihr auch kaum mehr, dass das neue Parteiprojekt, das Wagenknecht vorschwebt, kein linkes wäre. Denn zuvorderst wäre es eines für den Wutbürger:innenstammtisch, der Klimaschutz blöd, Impfen doof, Gendern scheiße, die EU bekloppt, die USA schrecklich, Geflüchtete noch schrecklicher, Wladimir Putins Russland hingegen töfte und die deutsche Nation toll findet.
Einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar vom März zufolge liegt das Wähler:innenpotential einer Wagenknecht-Partei bei 19 Prozent. Es setzt sich zu 41 Prozent aus der bisherigen Wähler:innenschaft der AfD und zu 22 Prozent aus der Anhänger:innenschaft der Union zusammen, erst dahinter folgen derzeitige Linkspartei-Unterstützer:innen mit 15 Prozent. Freilich sagt eine solche Potentialanalyse noch nichts über das wirkliche Wahlverhalten aus. Vor der vergangenen Bundestagswahl kam das Meinungsforschungsinstitut Insa zu dem Ergebnis, neun Prozent der Wähler:innen könnten sich vorstellen, das Team Todenhöfer zu wählen, tatsächlich erhielt es 0,5 Prozent der Zweitstimmen.
Aber aufschlussreich ist es schon. Wagenknechts Fangemeinde sei »konservativ, spießig und sieht keine Alternative zum Kapitalismus, will diese auch nicht«, konstatierte Thies Gleiss im Gespräch mit der Jungle World. Daher sei es auch »nicht politisch links einzubinden«, wie etliche traditionslinke Unterstützer:innen Wagenknechts innerhalb der Linkspartei glaubten, die sie »für ein Kaleidoskop unterschiedlicher Projekte und Erwartungen in Haftung und Hoffnung« nähmen. Für die Europawahl kann das reichen. Darüber hinaus dürfte es jedoch schwer werden. Offen ist, was bis dahin von der Linkspartei geblieben sein wird.


 Linke Heimatliebe
Linke Heimatliebe