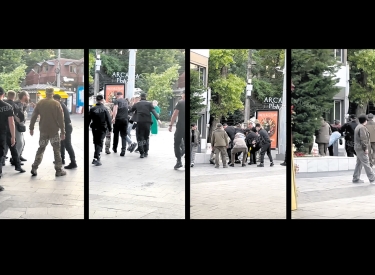Gute Pilze, böse Pilze

Von Pilzköpfen in der Kulturindustrie bis Pilzkulturen im Labor: die vielen Formen der Fungi
Bei einer sehr einfachen Anwendung der Zeichendeutung würde man vermutlich darauf kommen, dass der Pilz ein vollendetes Harmoniezeichen zwischen männlich und weiblich sei. Damit ist nicht so sehr die gelegentlich schon ins Obszöne lappende Ähnlichkeit mancher Pilzsorten zu menschlichen anatomischen Formen gemeint, sondern vielmehr eine abstrakte Poetik der semiotischen Grundkonstanten: Strich und Parallele, Kreis und Halbkreis, Punkt oder Gitter, das Verwurzelte und das Schwebende, das Geschützte und das Offene, das Sichtbare und das Unsichtbare. Der Pilz ist, jedenfalls in der Gestalt seines Fruchtkörpers, in der wir ihn vom Waldspaziergang oder Wochenmarkt her kennen, neben der kulinarischen stets eine ikonographische Herausforderung. Pilze gehören zu den ersten Dingen, die man als Kind zu zeichnen und zu bezeichnen lernt, und als solches semiotisches Basiswissen begleitet einen der Pilz ein Leben lang. Von hier an freilich wird’s kompliziert.
Man beginnt zu lernen, zum Beispiel, dass diese Pilze – Champignon, Röhrling, Hallimasch, Fliegenpilz – sehr spezielle Lebensformen sind, deren Eigenart so ausgeprägt ist, dass man sie weder im Pflanzen- noch im Tierreich verorten kann. Pilze betreiben keine Photosynthese, sondern müssen sich von organischen Substanzen ernähren. Man könnte auch sagen: Pilze »fressen«, und sie brauchen kein Licht. Das ist schon ein bisschen unheimlich.
Noch kein Abonnement?
Um diesen Inhalt zu lesen, wird ein Online-Abo benötigt::