Wahlen ohne Wähler
Eines ist klar nach der Parlamentswahl in Bulgarien, die gleichzeitig mit der Europawahl am 9.Juni stattfanden: Viele Menschen in Bulgarien waren bei der sechsten Wahl innerhalb von drei Jahren wahlmüde. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 34 Prozent die niedrigste seit der Entstehung des demokratischen Bulgarien im Jahr 1990 – obwohl gleichzeitig bei der Europawahl abgestimmt werden konnte.
Insgesamt zogen sieben Parteien ins bulgarische Parlament ein, einen klaren Wahlsieger gab es nicht. Der ehemalige Ministerpräsident Bojko Borissow erzielte zwar mit seiner Partei Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens (GERB) im Bündnis mit der Union der Demokratischen Kräfte (SDS) den höchsten Stimmenanteil von 24,7 Prozent. Damit ist das Bündnis jedoch weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Auf dem zweiten Platz landete mit 17,1 Prozent die Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS), die vor allem die türkische Minderheit vertritt. Angeführt wird die Partei von Deljan Peewski, einem Oligarchen und Medienunternehmer, gegen den die USA wegen Korruption Sanktionen verhängt haben. Drittstärkste Fraktion wurde mit knapp 14,3 Prozent die Koalition von »Wir setzen den Wandel fort« (PP) und Demokratisches Bulgarien (DB), die mit etwa zehn Prozentpunkten bei dieser Wahl die höchsten Verluste hinnehmen musste. Kiril Petkow, Vorsitzender von PP, ließ in einem Facebook-Video verlauten, man werde eine klare, aber konstruktive Oppositionsarbeit und gleichzeitig eine Politik für die EU und gegen Korruption machen.
Insgesamt stimmten über 25 Prozent der bulgarischen Wähler:innen für putinfreundliche Parteien.
Das Bündnis PP-DB hatte bei den jüngsten Wahlen noch so gut abgeschnitten, dass es zusammen mit GERB-SDS ein konservativ-liberales Kabinett bilden konnte, zunächst unter Ministerpräsident Nikolaj Denkow (PP) und seiner Stellvertreterin Marija Gabriel (GERB). Die beiden hätten eigentlich nach neun Monaten die Posten tauschen sollen. So weit kam es allerdings nicht, da die beiden Bündnisse nach Denkows vereinbartem Rücktritt keine Verständigung mehr erzielen konnten. GERB lehnte Reformen in den Bereichen Justiz, Wirtschaft und Nachrichtendiensten ab. Zudem führte die von Gabriel vorgeschlagene Kabinettsliste zu Unstimmigkeiten, sie war mit dem Bündnis PP-DB nicht abgesprochen und wurde von ihm abgelehnt. So kam es im März zu einer weiteren politischen Krise, eine Interimsregierung wurde ein- und eine Neuwahl angesetzt.
Das siegreiche Bündnis aus GERB und SDS bot anderen Parteien mittlerweile an, sich an einer von ihm dominierten proeuropäischen Expertenregierung zu beteiligen. Borissow möchte nach eigener Aussage nicht Regierungschef werden, beansprucht aber dieses Amt sowie Außen- und Verteidigungsministerium für GERB-SDS. Am Montag setzte er den potentiellen Koalitionspartnern eine Frist: Erhalte sein Bündnis nicht binnen einer Woche ausreichende Unterstützung für eine Regierungsbildung, werde es zu Neuwahlen kommen.
Neu im Parlament ist die 2023 registrierte nationalistische und putinfreundliche Partei Welitschie, was so viel wie »Herrlichkeit« heißt. Die Partei hat es geschafft, aus dem Stand heraus mit 4,5 Prozent der Stimmen 13 Abgeordnete in die Nationalversammlung (Narodno Sabranie) zu bringen. Sie ist vor allem in den sozialen Medien aktiv und verbreitet dort EU-Feindlichkeit und Verschwörungstheorien. Gegründet hat die Partei Iwelin Michajlow, ein vorwiegend im Immobiliengeschäft tätiger Unternehmer. Ihm werden dubiose Geschäftsmethoden zur Last gelegt; die Wochenzeitung Capital beispielsweise wirft ihm vor, ein Pyramidensystem aufgebaut zu haben. Michajlow bestreitet die Vorwürfe. Ein weiterer prominenter Vertreter der Partei ist Nikolaj Markow, ein ehemaliger Offizier des Inlandsgeheimdiensts Staatliche Agentur für nationale Sicherheit.
Verbindungen zur AfD
Welitschie sieht sich als Alternative zu der im Parlament ebenfalls vertretenen putinfreundlichen und rechtsextremen Partei Wasraschdane (Wiedergeburt), die kleine Zugewinne verbuchen konnte und auf 13,8 Prozent der Stimmen kam. Deren Vorsitzender Kostadin Kostadinow hatte der deutschen AfD Ende Mai angeboten, sich nach deren Ausschluss aus der Fraktion Identität und Demokratie (ID) einer neuen, »wahrhaft konservativen und souveränen« Fraktion im EU-Parlament anzuschließen. Verbindungen zwischen den Parteien bestehen bereits. So ist dem Nachrichtenportal Euractiv zufolge die Bulgarin Rada Laikowa Vorsitzende der Parteisektion von Wasraschdane in Berlin und gleichzeitig als Beraterin der AfD für internationale Angelegenheiten im deutschen Bundestag tätig.
Die Bulgarischen Sozialistischen Partei (BSP), die Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei, verliert immer mehr an Unterstützung, sie erreichte bei den Wahlen nur 7,1 Prozent. Daraufhin reichte die BSP-Vorsitzende Kornelija Ninowa ihren Rücktritt ein. Auch die BSP war in der Vergangenheit immer wieder mit putinfreundlichen Standpunkten aufgefallen. Insgesamt stimmten damit über 25 Prozent der bulgarischen Wähler:innen für prorussische Parteien.
Putinfreundliche Positionen und Verbindungen nach Deutschland haben auch zwei paramilitärische Gruppen, deren Auflösung die bulgarische Staatsanwaltschaft kürzlich beantragte. Es handelt sich dabei um die beiden Gruppen Schipka und die Militärische Union Wassil Lewski. Neue Erkenntnisse über Verbindungen zu deutschen Rechtsextremisten hätten den Ausschlag für das Verbotsverfahren gegeben, wie Euractiv berichtete. Bereits im Jahr 2016 hatten sich die ehemalige Pegida-Aktivistin Tatjana Festerling und Edwin Wagensveld von der niederländischen Pegida in Militäruniformen mit den beiden paramilitärischen Einheiten und deren Emblemen an der bulgarisch-türkischen Grenze ablichten lassen. Der Anführer der beiden Gruppen, Wladimir Russew, hatte sich damals in der Öffentlichkeit als »Walther Kalaschnikow« bezeichnet, eine Kombination aus der deutschen Walther-Pistole und der russischen Kalaschnikow.
Im Jahr 2016 hatte der damalige Ministerpräsident Borissow die Arbeit der zahlreichen rechtsextremen und paramilitärischen Gruppen gelobt. Der damalige Grenzpolizeileiter Antonio Angelow hatte sogar der – bis heute existierenden – nationalistischen Gruppe »Organisation zum Schutz der bulgarischen Bürger« eine Auszeichnung verliehen, nachdem sie eigenständig Geflüchtete an der bulgarisch-türkischen Grenze festgesetzt hatte.





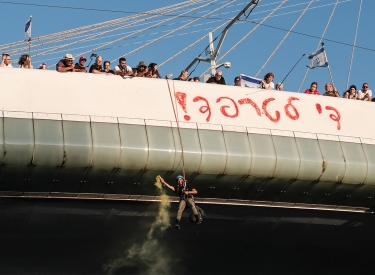
 Planlos in Doha
Planlos in Doha
