»Israel ist hier, um zu bleiben«
Ihr zusammen mit Einat Wilf verfasstes Buch »Der Kampf um Rückkehr«, das zuerst 2020 erschien, haben Sie in den vergangenen Tagen in Leipzig, Jena und München vorgestellt. Wie haben Sie Ihren Aufenthalt hier erlebt?
Obwohl der 7. Oktober in Israel stattfand und wir Israelis diejenigen sind, die sich im Krieg befinden, hatte ich das Gefühl, dass die Menschen in Deutschland, die für Israel eintreten, gestärkt werden müssen. Wir wissen, dass die Atmosphäre nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und in den USA sehr gewalttätig ist.
Der Untertitel des Buchs lautet: »Wie die westliche Nachsicht für den palästinensischen Traum den Weg zum Frieden behindert hat«. Was ist der palästinensische Traum?
Der Traum vieler Palästinenser ist es, das ganze Gebiet zu kontrollieren. Und ich glaube, nach dem 7. Oktober ist die Bedeutung der Parole »From the river to the sea« klar. Das Interessante ist, dass man einfach zuhören muss. Es ist nicht sehr kompliziert. Es gibt eine Tendenz, vor allem in westlichen Ländern, vieles besser zu wissen, im Sinne von: »Oh, sie meinen bestimmt etwas anderes, sie wollen bestimmt etwas anderes.« Nein, man muss ihnen nur zuhören.
In dem Buch nennen Sie dieses Phänomen »Westplaining«, in Anlehnung an »Mansplaining«, das bevormundende und herablassende Verhalten von Männern gegenüber Frauen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Im Jahr 2018 gab es jede Woche den »March of Return« im Gaza-Streifen in der Nähe der Grenze zu Israel. Schon damals haben die Demonstranten gesagt: »Wir werden unser Land zurückerobern.« Ich hatte mir damals auf der Website der New York Times ein Video von einem US-amerikanischen Reporter angeschaut. Er fragt eine Frau in Gaza, warum sie da sei. Und sie antwortet: »Wir sind hierhergekommen, um zurückzukehren. Sehen Sie das Land hinter dem Zaun? Es gehört uns.« Und dann geht der Reporter zur Kamera und sagt: »Ja, wie Sie sehen können, protestieren die Menschen in Gaza gegen die wirtschaftliche Situation.« Also kein Verständnis, kein sachliches Zuhören seitens des Reporters. Was viele Palästinenser wollen, ist genau das, was sie seit der Staatsgründung Israels 1948 wollen und was sie auch vorher schon wollten. Es ist sehr wichtig zu hören, was sie sagen.
»Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate das Abraham-Abkommen zur Zusammenarbeit mit Israel unterzeichnet hatten, haben sie die Finanzierung der UNRWA eingestellt.
Und worin besteht nun die Nachsicht von westlichen Staaten?
Nehmen wir Deutschland als Beispiel: Mehr als zehn Millionen Deutsche mussten nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa fliehen. Am Anfang wollten auch sie zurückkehren. Aber die »internationale Gemeinschaft« hat ihnen gesagt, dass das nicht passieren wird, weil dann wieder Krieg ausbrechen würde. Die deutsche Bevölkerung war nicht glücklich darüber, aber sie hat es akzeptiert. Von den Palästinensern erwarte ich auch nicht, dass sie glücklich sein werden. Ganz im Gegenteil, es ist eine traurige Sache. Kriege sind schrecklich. Juden wurden im Krieg getötet. Araber wurden getötet. Den Palästinensern muss von den westlichen Staaten deutlich gemacht werden, dass es kein Rückkehrrecht gibt. Die Existenz der UNRWA bezeugt allerdings fortwährend die westliche Nachsicht.
Nachdem Israel UNRWA-Mitarbeiter der Beteiligung an den Massakern vom 7. Oktober beschuldigt hatte, stellte Deutschland seine Zahlungen ein, Mitarbeiter wurden suspendiert. Später wurden die Zahlungen wiederaufgenommen, da die UNRWA als unverzichtbare humanitäre Organisation gilt. Bestreiten Sie diese Wahrnehmung?
Ja, das ist ein Missverständnis. Die UNRWA ist keine humanitäre Organisation, sondern ein Hindernis für den Frieden. Letztlich ist es eine Organisation für den Krieg und ein Instrument der Palästinenser, diesen Krieg fortzusetzen. Zentral für die Verlängerung des Konflikts ist die Flüchtlingsdefinition der UNRWA. Würde man die internationale Flüchtlingsdefinition statt der eigenen anwenden, gäbe es statt sechs Millionen Flüchtlingen vielleicht 200.000. Man muss sich fragen, warum diese UN-Einrichtung, die ein begrenztes Budget hat, die Zahl der Flüchtlinge um das 30fache erhöht. Das ist politisch motiviert. Sie sagen den Flüchtlingen, sie sagen den Palästinensern: »Euer Traum ist legitim.« Übrigens sprechen Generalkommissare der UNRWA vom Recht auf Rückkehr. Ich möchte klarstellen, dass es so etwas im internationalen Recht nicht gibt.
Vor einigen Tagen hat Benny Gantz, Mitglied im fünfköpfigen israelischen Kriegskabinett, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisiert, weil er keinen Plan für die Nachkriegsordnung habe. Wie beurteilen Sie diese Auseinandersetzung und welche Rolle wird die UNRWA nach dem derzeitigen Krieg im Gaza-Streifen spielen?
Die UNRWA sollte nicht an irgendwelchen Projekten beteiligt sein. Sie hätte vor dem Krieg aufgelöst werden müssen. Was die Nachkriegsordnung anbelangt: Die Frage ist nicht, wer regieren wird. Es kann der saudische König sein oder der Papst. Die Frage ist der Inhalt dieser Autorität: Wie wird sie die Palästinenser auf eine Koexistenz mit den Israelis vorbereiten?
Kritiker würden sagen, dass die Auflösung einer Organisation, die seit über 70 Jahren als quasistaatlicher Akteur Sozial-, Gesundheits- und Bildungsdienste anbietet, politisch unrealistisch ist.
Es ist im Grunde ganz einfach. In der Westbank gibt es die Palästinensische Autonomiebehörde (PA). Es gibt also Schulen, Kliniken und alle möglichen Einrichtungen der PA. Und daneben gibt es Schulen von der UNRWA. Unser Vorschlag ist ganz einfach: Diese Schule bleibt, was sie ist. Die Klasse bleibt, also die Stühle, die Tafel, die Kreide. Alles bleibt, wie es ist. Die Kinder sind dieselben. Sie werden weiterhin in dasselbe Gebäude gehen. Die Lehrer bleiben dieselben Lehrer. Wir schlagen nur vor, dass sie nicht von der UNRWA, sondern von der PA bezahlt werden. Ich stimme Ihnen zu: Die politische Bedeutung wäre enorm. Aber worauf warten wir? Auf einen weiteren 7. Oktober?
Deutschland ist nach den USA der größte Geldgeber der UNRWA. Die Zahlungen einzustellen, ist eine folgenreiche Entscheidung.
Es wäre das eine, aus deutscher Perspektive zu sagen: »Das ist ein komplizierter Konflikt. Lasst uns damit in Ruhe. Wir haben in Europa den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben Zuwanderung, Energiepreise et cetera.« Das könnte ich verstehen. Aber das andere ist, sich einzumischen, den Anspruch zu erheben, den Frieden zu fördern. Ich weiß, dass es schwierig ist, diese Konsequenzen zu ziehen. Aber so abgeschlachtet zu werden, wie wir am 7. Oktober abgeschlachtet wurden, ist noch schwieriger. Es gehört Mut dazu, den Palästinensern deutlich zu sagen, dass die UNRWA Teil des Problems ist. Viele arabische Länder wissen das. Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate das Abraham-Abkommen zur Zusammenarbeit mit Israel unterzeichnet hatten, haben sie die Finanzierung der UNRWA eingestellt. Sie haben ganz klar verstanden, dass sie keinen Frieden mit Israel haben und gleichzeitig die UNRWA weiter finanzieren können.
»Die Juden wollen einen Staat, die Araber wollen, dass die Juden keinen Staat haben.«
Welches Umdenken in Hinsicht auf den israelisch-arabischen Konflikt halten Sie für notwendig?
Wir wissen alle, wie der Konflikt enden wird. Beide Seiten sind an einer Zweistaatenlösung interessiert. Das ist die einzige realisierbare Option. Die Frage ist nur noch, wie man dahin kommt. Aber wegen dieser Extremisten ist zunächst einmal ein Paradigmenwechsel nötig, nämlich die wahre Natur des Konflikts anzuerkennen: Die Juden wollen einen Staat, die Araber wollen, dass die Juden keinen Staat haben. Hierin sind sich die Hamas und die Bevölkerung im Gaza-Streifen wohl größtenteils einig: Beide wollen den Staat Israel zerstören. Das machen Umfragen auch nach dem 7. Oktober deutlich. Wenn man das verstanden hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, zu versuchen, die Juden zu überreden, dass sie keinen Staat bräuchten. Oder man versucht, die Araber davon zu überzeugen, dass sie neben einem jüdischen Staat leben können. Als Israeli unterstütze ich natürlich die zweite Möglichkeit. Ich möchte in einem unabhängigen jüdischen Staat bleiben. Der Paradigmenwechsel in Deutschland und international sollte sich auf die Palästinenser konzentrieren und ihnen sagen: Israel ist hier, um zu bleiben. Ihr müsst damit leben.
Und wie debattiert die israelische Linke darüber?
Das Interessante an der israelischen Linken ist, dass sie jahrelang davon überzeugt war, es handle sich um ein territoriales Problem. Ich dachte auch lange, dass die Palästinenser in den achtziger oder neunziger Jahren einen Wandel vollzogen hätten. Das war der Grund, warum dem Oslo-Abkommen 1993 zugestimmt wurde. Wir dachten also: Okay, sie sind bereit, neben den Israelis und nicht an ihrer Stelle zu leben; das Rückkehrrecht ist nicht wichtig, sondern vielmehr Verhandlungsmasse.
Gibt es in der israelischen Linken noch Kräfte, die das Rückkehrrecht akzeptieren?
Ich kenne niemanden in der israelischen Linken, der diese Position vertritt – außer bei den extremen antizionistischen Linken, die in Israel ein oder zwei Prozent ausmachen. Sie sind laut, weil einige von ihnen in Zeitungen schreiben und in der Wissenschaft arbeiten. Aber bei Umfragen oder Wahlen ist die antizionistische Linke in Israel bedeutungslos. Ich glaube nicht, dass es eine zionistische Linke gibt, die dem Rückkehrrecht zustimmt, selbst Meretz nicht, die linkeste Partei. Denn das Rückkehrrecht widerspricht dem Zionismus.
*
Adi Schwartz ist ein israelischer Wissenschaftler und Autor, der sich auf die Geschichte Israels und der Juden aus arabischen Ländern sowie das palästinensische Flüchtlingsproblem spezialisiert hat. Vor seiner Promotion über den arabisch-israelischen Konflikt am Institut für Politikwissenschaft der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan war er als Fellow am dortigen Center for International Communication tätig. Außerdem war er Forschungsstipendiat des US-amerikanischen Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP). Schwartz war Redakteur der israelischen Tageszeitung »Haaretz« und veröffentlicht als freier Journalist in internationalen Medien wie dem »Wall Street Journal«.


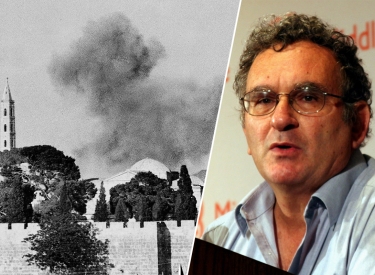

 Krieg führen
Krieg führen



