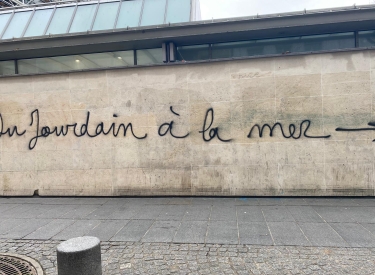Sicherer Hafen in Gefahr
Nach London und Paris lebt in Marseille heutzutage die drittgrößte jüdische Gemeinde Europas. Sie hat eine wechselvolle Geschichte. Erstmals ist die Präsenz von Juden in Marseille für das 6. Jahrhundert belegt. 1501 wurden die Juden der Provence vertrieben; es war die Zeit, als sich das Königreich Frankreich das Gebiet Stück für Stück einverleibte. Sie überdauerten in Avignon und anderen damals vom Papst regierten Gebieten. Diese juifs du pape (Juden des Papstes) bildeten zusammen mit Aschkenasim die beiden bedeutendsten jüdischen Gruppen in Marseille vor dem Zweiten Weltkrieg.
Bereits im August und September 1942 lieferte das Vichy-Regime dem Deutschen Reich 1.928 ausländische Juden aus, die im Camp des Milles bei Aix-en-Provence interniert waren; damals waren noch keine deutschen Einheiten in der Region präsent.
Die Juden Marseilles litten stark unter der Shoah. Bereits im August und September 1942 lieferte das Vichy-Regime dem Deutschen Reich 1.928 ausländische Juden aus, die im Camp des Milles bei Aix-en-Provence interniert waren; damals waren noch keine deutschen Einheiten in der Region präsent. Im November 1942 rückten deutsche Truppen auch in Südfrankreich ein, 1943 erlebte Marseille die größte gegen französische Juden gerichtete Razzia des Kriegs: Im Zuge der Zerstörung des Stadtviertels Le Panier nördlich des Alten Hafens, das die Nazis als »Schweinestall« bezeichneten, deportierten die deutschen Besatzer mit Hilfe der französischen Behörden über 1.600 Personen, darunter fast 800 Juden.
Die französischen Juden waren damals sehr stark assimiliert. Sie waren seit Jahrhunderten Franzosen und viele hatten das Land im Ersten Weltkrieg verteidigt. Über seine Großeltern erzählt Laurent Cohen, ein freundlicher 50jähriger Unternehmer, der von einem jüdischen Vater aus der Provence und einer jüdischen Mutter aus Algerien abstammt, der Jungle World: »Bei ihnen gab es eine schreckliche Bitterkeit gegenüber einigen Franzosen. Es herrschte das Gefühl, dass man trotz allem als Jude nie vor Verfolgung sicher ist, selbst nach Jahrhunderten.« Dutzende Mitglieder seiner Familie wurden deportiert und ermordet.
Die meisten algerischen Juden gingen nach Frankreich
Diese Generation, die die jüdische Religion ohnehin wenig praktizierte, habe mit dem Gedanken gelebt, »zu Hause Jude zu sein und draußen wie alle anderen«, sagt der 53jährige Jean-Jacques Zenou der Jungle World. Er ist der Direktor von Radio JM, dem jüdischen Radiosender von Marseille. Auch er hat ein doppeltes Erbe: Die Familie seiner Mutter stammt aus Thessaloniki und Bulgarien und musste die Shoah erleben; sein Vater stammt aus einer Familie ländlicher Juden aus Laghouat im Süden Algeriens.
Als Algerien 1962 unabhängig wurde, verließen fast alle europäischstämmigen Bewohner das Land. Über eine Million sogenannte Pieds-noirs siedelten nach Frankreich über. Auch fast alle der rund 140.000 algerischen Juden verließen Algerien, heutzutage leben dort weniger als 200. Schon im römischen Zeitalter hatten Juden in Algerien gelebt; im 15. und 16. Jahrhundert kamen zu diesen Sepharden hinzu, die vor der Judenverfolgung in Spanien nach Nordafrika flohen. Doch nach der Unabhängigkeit Algeriens sahen deren Nachkommen keine Zukunft mehr für sich. Einige wanderten nach Israel aus, die meisten jedoch gingen nach Frankreich. Oft führte ihr Weg über Marseille, wo sich Zehntausende niederließen.
Wie auch die anderen Gesprächspartner der Jungle World erinnert sich Zenou mit strahlenden Augen an die goldenen Jahre, die die jüdische Gemeinde von Marseille nach der Ankunft der Emigranten aus Algerien erlebte. »Zwischen den siebziger und nuller Jahren sahen wir 30 Jahre lang eine gute Entwicklung der Gemeinschaft. Die sephardischen Juden brachten einen Aufschwung, eine ganz andere Lebensweise, sehr mediterran. Sie hatten eine Lebensfreude, eine Art zu feiern, die völlig anders war als bei den in Frankreich geborenen Juden, die zurückhaltender waren. Es war ein Kulturschock.« Diesen hätten beide Seiten erlebt: »Als mein algerischstämmiger Großvater meine Mutter zum ersten Mal sah, sagte er auf Arabisch zu seinem Sohn: ›Aber sie ist nicht jüdisch!‹ Und dann arbeitete sie auch noch. ›Wie kommt es, dass eine Frau arbeitet?‹ Das war 1965!«
Juden machen fast zehn Prozent der Bevölkerung Marseilles aus
Michel Cohen-Tenoudji, der Präsident des israelitischen Konsistoriums von Marseille, sagt dazu der Jungle World: »Davor gab es ein oder zwei Synagogen. Die nordafrikanischen Juden haben durch ihre Zahl, ihre Lebhaftigkeit und ihre religiöse Observanz einen großen Aufschwung bewirkt. Aus ein paar Tausend Juden wurden 76.000. Heute gibt es 60 Synagogen.« Juden machen fast zehn Prozent der Bevölkerung Marseilles aus.
Die Juden Algeriens waren mit dem Décret Crémieux 1870 französische Staatsbürger geworden, sprachen Französisch und waren oft gebildet, insbesondere die aus Algier und anderen großen Städten. Ihnen fiel es vergleichsweise leicht, in Frankreich Fuß zu fassen, auch wenn sie durch die Emigration alles verloren hatten. Institutionen wie jüdische Kulturzentren und die Éclaireuses et éclaireurs israélites de France (jüdische Pfadinderinnen und Pfadfinder) halfen dabei. Die Pfadfinder spielten auch während des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle im Widerstand gegen die Nazis und bei der Rettung provenzalischer Juden, insbesondere von Kindern.
Marseille ist bekannt für das gute Zusammenleben der verschiedenen kulturellen Gruppen, das auch von der Stadtverwaltung gefördert wird, und galt lange Zeit als ein friedlicher Zufluchtsort, der das Gedeihen eines reichen jüdischen Lebens ermöglichte. »Marseille ist ein Hafen«, sagt Jean-Jacques Zenou. »Es gibt eine multikulturelle Identität, man hat keine Angst vor der Andersartigkeit. Es gibt keine geographische Spaltung zwischen Vorstädten und Stadtzentrum. OM (der Fußballverein Olympique de Marseille; Anm. d. Red.) ist ebenfalls ein Faktor, der dieses Zusammenleben ermöglicht. Im Stadion gibt es keine sozialen Klassen, keine Religion … Es herrscht Begeisterung rund um OM. Jeder fühlt sich gleich.«
Die islamistische Bedrohung wächst
Die Situation hat sich jedoch in den vergangenen zehn Jahren verändert. Der israelisch-palästinensische Konflikt wurde gleichsam importiert, die islamistische Bedrohung wächst. Abgeordnete von Jean-Luc Mélenchons Partei La France insoumise, die in Marseille ihren Hauptsitz hat, äußerten sich jüngst feindselig und verharmlosten Antisemitismus.
Deshalb äußern alle Gesprächspartner der Jungle World Besorgnis, Traurigkeit, ja sprechen sogar von Wut und einem Zerwürfnis. Eine Situation, die der extremen Rechten zugutekommt: Zum ersten Mal hätten einige Juden bei den Parlamentswahlen im vergangenen Juni für den Rassemblement national Marine Le Pens gestimmt, berichtet Michel Cohen-Tenoudji, eine Wahlentscheidung, die zuvor »nicht koscher war«.
Mittlerweile seien die meisten Juden aus den nördlichen Vierteln Marseilles weggezogen, kaum ein jüdisches Kind besuche dort noch eine öffentliche Schule, sagt Laurent Cohen. Auf der Straße eine Kippa zu tragen, sehen viele als gefährlich an. Davon riet schon 2016 Zvi Ammar, der damalige Präsident des israelitischen Konsistoriums, ab, nachdem ein 15jähriger Junge den 35jährigen Lehrer Benjamin Amsellem auf offener Straße mit einer Machete verwundet hatte.
Drohungen und Angriffe gegen Juden vervielfacht
Amsellem trug eine Kippa, als er auf dem Weg zur Schule überfallen wurde, und entkam dem Tod, indem er sich mit seiner Tora verteidigte. Der jugendliche Täter sagte später, er habe »im Namen Allahs und des Daesh« gehandelt. Dieser Angriff schockierte die Juden in Marseille. Zwar hatte es auch im Vorjahr einige antisemitische Attacken gegeben, doch war die Stadt von größeren Anschlägen verschont geblieben.
Cohen-Tenoudji unterscheidet »zwei Perioden: vor dem 7. Oktober und danach«. Er beklagt eine starke Verschlechterung der Beziehungen zu den muslimischen Gemeindevertretern: »Es gab einige Stellungnahmen im Privaten, aber die meisten hüllten sich in großes Schweigen. Nach diesem genozidalen Pogrom gab es Versuche, das Unentschuldbare zu rechtfertigen.« Zenou weist aber auch darauf hin, dass, wenn er muslimische Gemeindevertreter zu gemeinsamen Gedenkveranstaltungen einlade, viele von ihnen Angst äußerten vor radikalisierten Mitgliedern ihrer eigenen Gemeinde: »Sie riskieren damit heute ihr Leben.« Jedenfalls haben sich die Drohungen und Angriffe gegen Juden vervielfacht. »Das Auto meines Sohns wurde mit einem Davidstern markiert. Wie konnte es so weit kommen?« fragt sich Laurent Cohen.
Der Präsident des israelitischen Konsistoriums von Marseille, Michel Cohen-Tenoudji, unterscheidet »zwei Perioden: vor dem 7. Oktober und danach«.
Lionel Stora ist Präsident des Fonds social juif unifié (FSJU) in der Region Provence, eines Verbandes, der 1951 gegründet wurde, um den Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Frankreich nach der Shoah zu fördern. Er ruft im Gespräch mit der Jungle World zur Wachsamkeit auf gegenüber den »Populismen, deren Mechanismus darin besteht, möglichst viele Menschen mit einigen griffigen Slogans zusammenzubringen«. Die große Herausforderung für die Juden bestehe darin, »sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Das ist ein grundlegendes Prinzip des Judentums: der Respekt vor dem Laizismus und dem Staat, der der unsere ist. Das Gesetz des Landes hat Vorrang im Falle eines Konflikts mit dem religiösen Gesetz. Wir haben die Pflicht, für die französische Republik zu beten.«
Seiner Ansicht nach sind »die Probleme vor allem gesellschaftlicher Natur. Sie betreffen nicht nur die Juden. Aber mit den Juden geht es los: Wenn sie misshandelt werden, muss man nur darauf warten, bis die ganze Gesellschaft ebenfalls drankommen wird.«
Stellt sich also die Frage, ob es für die Juden eine Zukunft in Marseille gibt? »Eines Tages wird der Krieg enden, aber wenn die Risse zu tief sind, bleibt eine Narbe: Es wird nicht mehr wie zuvor sein«, befürchtet Michel Cohen-Tenoudji. Dennoch hoffen alle auf eine bessere Zukunft, auch wenn erneut dunkle Zeiten am Horizont zu stehen scheinen. Diese Haltung fasst Laurent Cohen so zusammen: »Gott wird uns helfen. Die Juden haben immer auf das Beste gehofft und sich auf das Schlimmste eingestellt. Ich hoffe, dass am Ende des Tunnels Licht ist.«


 Immer auf der anderen Seite: die Harkis
Immer auf der anderen Seite: die Harkis