Heide, Blut und Kartoffeln
Das aktuelle Unterhaltungskino ist prallvoll mit Subtext. Hier mit erotischen, da mit politischen und dort mit kulturkämpferischen Zweit- und Drittbedeutungen. Das hat nur entfernt mit Subversion und ästhetischer Schmuggelware zu tun, dafür um so mehr mit Vermarktungsstrategien. Mehrfache Lesbarkeit erweitert den Kreis des angesprochenen Publikums; das fängt schon mit den Abenteuer- und Spaßeffekten von Animationsfilmen für die ganze Familie an, hinter denen sich durchaus manche geistreiche Anspielung und ein Hauch von Gesellschaftssatire für die Älteren verbergen können. Die großen Franchise-Serien über Superhelden, Wüstenplaneten oder Affenstaaten sind, nachdem sich die Effekte der computergenerierten Bilder etwas verbraucht haben, ohnehin schon als Subtext-Schleudern in Verruf geraten. Und manches davon ist schon nicht mehr nur mehrfach, sondern fast schon beliebig lesbar.
Das Gegenbild zur postmodernen Subtextmaschine ist die Konzeption des bürgerlichen Melodramas, die sich als melodramatische Erzählweise auch ins Kino hinübergerettet hat. Hier werden die einzelnen Elemente des Dramas so unter Druck gesetzt, dass sie nicht anders können, als sich zu einem fundamentalen Selbstausdruck zu entwickeln: Das Böse setzt sich aus Zeichen des Bösen zusammen, das Licht spricht moralische Urteile, und Farbe und Form eines Kleides erzählen, was an der Balance von Liebe, Ordnung und Sexualität funktioniert und was schiefgegangen ist. Und wenn etwas immer noch nicht klar genug ist, muss eben davon geredet werden.
Es ist ein Film für Leute, die ins Kino gehen, um »schöne Bilder«, »tolle Schauspieler«, »starke Gefühle« und überhaupt »großes Kino« zu sehen. Für Leute, die beim Sehen auch noch denken, ist das eher nichts.
»The King’s Land« von Regisseur Nikolaj Arcel und seinem Co-Drehbuchautor Anders Thomas Jensen ist ein melodramatischer Film par excellence. Im dänischen Original ist er treffender und melodramatischer »Bastarden« betitelt. Er basiert auf dem Bestseller-Roman »Kaptajnen og Ann Barbara« von Ida Jessen, die im Übrigen für sehr Erbauliches und sehr Dänisches bekannt ist, für Kinder wie für Erwachsene, und die es der Leserschaft nicht eben schwermacht, das Böse vom Guten zu trennen.
Die beiden Protagonisten sind daher sozusagen auch philosophisch schärfstens konturiert: Da ist ein böser Gutsherr, der glaubt, dass alles in der Welt und Gott im Besonderen nichts anderes als das Chaos ist, und da ist ein guter ehemaliger Offizier, der »Kaptajn« eben, zu Deutsch ein Hauptmann, der an den Auftrag Gottes glaubt, dass der Mensch im Allgemeinen und er selber ganz besonders dazu bestimmt ist, das Chaos der Natur und der Lebewesen darin zu bändigen.
Da beide diese ihre Grundüberzeugungen oft genug für sich selbst und gegeneinander äußern, liegt das religionspolitische Gleichnis einer existentiellen Gegnerschaft offen genug zu Tage: Der barbarische Pantheismus des Feudalismus gegen den zivilisatorischen Schöpfungsauftrag des vorkapitalistischen Protestantismus.
Besiedlung im Namen des Königs
Aber der Reihe nach. Der dänische König Frederik V., der übrigens nur von hinten in einem Über-die-Schulter-Blick auf seinen Hofstaat gefilmt wird, beginnt im Jahr 1755 eine Kampagne zur Besiedlung der »wilden Heide« Jütlands. Dort sind bislang alle Versuche der Urbarmachung ebenso wie die Kämpfe gegen die »Gesetzlosen«, die hier Zuflucht gefunden haben, gescheitert. Auftritt des ehemaligen Offiziers, Hauptmann in der dänischen Armee, Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), der sich anerbietet, im Namen des Königs einen neuen Versuch zur Besiedlung zu wagen, auf eigene Rechnung und für das Versprechen von Landbesitz und Adelstitel. Das hat, wie der Originaltitel es andeutet, auch mit einer finsteren Familiengeschichte zu tun. Der Hofstaat, korrupt und unfähig, wie Hofstaaten nun einmal sind, lässt ihn nach den üblichen Demütigungen dann doch gewähren, vor allem um den guten König hinters Licht zu führen.
Und Ludvig fängt an zu graben und zu bauen, muss unzuverlässige Arbeiter ersetzen, zuerst durch ein Paar Pachtbauern, die ihrem brutalen Herrn, dem schurkischen Gutsbesitzer Frederik De Schinkel (Simon Bennebjerg), entflohen sind, dann durch eine Gruppe Gesetzloser, schließlich durch deutsche Siedler. Aus Deutschland hat er auch die Frucht, die er hier, gegen alle Unbill, anzubauen gedenkt: die Kartoffel.
Bevor er damit schließlich wider Erwarten des Hofstaats und des fiesen Gutsherren doch Erfolg hat, muss er sich in einen schrecklichen Kampf mit dem Gutsherren bewähren, der sich als Herr über das kultivierte wie über das wilde Land fühlt und der von einem Lars-von-Trier-Film das Motto übernommen zu haben scheint: Chaos regiert. Der Kampf kostet Opfer, auf beiden Seiten, vor allem bei der Ersatzfamilie, die sich im Haus Ludvigs gebildet hat: der Pionier, die entlaufene Leibeigene und das »Zigeuner«-Mädchen, das bei den Gesetzlosen aufgewachsen ist. Und wie wir es von Moses kennen: Ludvig kann das gelobte Land errichten, aber er selbst kann darin nicht Heimat finden. Am Ende wird er auch von seiner Ziehtochter verlassen, die mit der »Zigeuner«-Gruppe davonzieht. Wir verstehen schon, das Blut …
Melodramatische Überdeutlichkeiten
Das ist die letzte der vielen melodramatischen Überdeutlichkeiten, die die Geschichte zu bieten hat. Die Hofschranzen sind hofschranzig, der König ist königlich, der entschlossene Held ist heldisch entschlossen, der sadistische Bösewicht ist so böse sadistisch, dass selbst seiner Gefolgschaft bei der brutalen Folterei, vorzugsweise mit Peitsche und heißem Wasser, der Spaß vergeht, die wilde Landschaft ist schön wild, und die Heide erstreckt sich ziemlich weit unterm Himmel. Harte Arbeit ist schweißtreibend, und Rechtlose sind verdammt rechtlos.
Es ist ein Kino der alten Art, die Verbindung des europäischen Historienfilms mit dem Western, und so bietet der Film alles das, was man von diesen beiden Genres erwartet, nur eben so, als spiele es nicht im Neverland der Traumfabrik, sondern in der realen Geschichte Nordeuropas. Dazu Mads Mikkelsen auf dem Höhepunkt der Mads-Mikkelsenhaftigkeit, der eine der Ambivalenz weitgehend beraubte Replik seiner Rolle aus Arnaud des Pallières’ »Michael Kohlhaas« von 2013, der seinerseits schon eine Art Western à rebours war.
Man hätte diese Geschichte als Metapher von Landnahme und ursprünglicher Akkumulation erzählen können, als Ausgangspunkt der kommenden Klassenkämpfe, oder als finstere Dekonstruktion einer Gründungslegende, wie es in den USA bei manchen Post- und Anti-Western gelingt.
Natürlich hätte man diese Geschichte als Metapher von Landnahme und ursprünglicher Akkumulation erzählen können, als Ausgangspunkt der kommenden Klassenkämpfe, oder als finstere Dekonstruktion einer Gründungslegende, wie es in den USA bei manchen Post- und Anti-Western gelingt. Stattdessen entschied sich der Regisseur sozusagen antimodern für ein retromanisches Historienmelodram mit Anklängen an sadistische Rache-Western, Soap Opera mit einem unguten Blut- und Boden-Beigeschmack. Das wird der Historie nicht gerecht, aber genauso wenig den Charakteren, die immer nur darstellen und nie wirklich leben. Sie existieren für den Mythos, bis hin zum jugendlich-schönen Pastor, der gar nicht anders kann, als den Opfertod zu sterben.
Es ist ein Film für Leute, die ins Kino gehen, um »schöne Bilder«, »tolle Schauspieler«, »starke Gefühle« und überhaupt »großes Kino« zu sehen. Für Leute, die beim Sehen auch noch denken, ist das eher nichts. Oder, schlechter gelaunt gesagt: Die Grenze zwischen dem Konservativen und dem Reaktionären wird in »Bastarden« mehr als einmal überschritten. Politisch wie ästhetisch. Auch im Kino, so scheint es, beginnt sich alles rückwärts zu drehen.
King’s Land (Dänemark / Deutschland /Schweden / Norwegen 2023). Buch: Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen. Regie: Nikolaj Arcel. Darsteller: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg. Start: 6. Juni







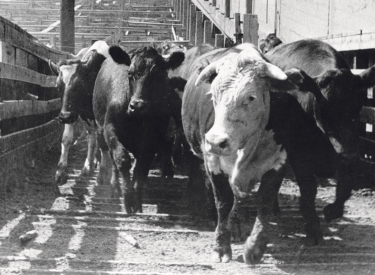
 Fortschritt in the Slaughterhouse
Fortschritt in the Slaughterhouse
