Hasenherz und Männersuppe
»Gier, Missachtung der Natur, Selbstsucht, mangelnde Vorstellungskraft, endlose Rivalität und Verantwortungslosigkeit haben die Welt zu einem Objekt gemacht, das in Stücke geschnitten, verbraucht und zerstört werden kann. Deshalb glaube ich, dass ich Geschichten erzählen muss, als ob die Welt eine lebendige, einzelne Einheit wäre, die ständig vor unseren Augen entsteht, und als ob wir ein kleiner und gleichzeitig mächtiger Teil davon wären.« So endete Olga Tokarczuks Dankesrede bei der Entgegennahme des Literaturnobelpreises 2019 in Stockholm. Diese klugen Sätze kann man auch auf ihren Roman »Empusion. Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte« beziehen, einer Art feministischer Neuschreibung von Thomas Manns »Der Zauberberg«.
Der seltsame Titel des im Frühsommer auch auf Deutsch erschienenen Romans ist ihre eigene Wortschöpfung, ein Kofferwort aus »Empusen« – in der griechischen Mythologie weibliche Dämonen, die sich vampirartig am Blut der Männer laben – und »Symposion« – ein Trinkgelage, bei dem philosophiert wird. Beides spielt im Roman eine Rolle.
Getrunken wird jedenfalls recht ordentlich in dem schlesischen Sanatorium für Tuberkulosekranke in Görbersdorf, »diesem seltsamen Ort, voller Mysterien«, dem Schauplatz der Erzählung: ein undurchsichtiges Getränk mit dem herrlichen Namen »Schwärmerei«, das angeblich gut für die Lunge ist. Es kann Halluzinationen auslösen und lässt die misogyne, »von den Koch’schen Bazillen kolonisierte« Männerrunde noch hemmungsloser in ihren Äußerungen werden.
Zwar freut man sich, dass Tokarczuk den Männern so schön alberne Namen verpasst hat, ein wenig erschöpfend ist es aber schon, immer wieder seitenweise zutiefst sexistische Litaneien über sich ergehen lassen zu müssen.
Doch zunächst einmal betritt Tokarczuks Hans Castorp im September 1913, knapp ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Bildfläche: Mieczysław Wojnicz ist wie Manns Romanfigur ein junger Student der Ingenieurswissenschaften mit der Diagnose Schwindsucht. Er wirkt, als wäre er »aus dem Jenseits in die melancholischen Berge gekommen«. So jedenfalls beschreiben es die mysteriösen Stimmen, die die Geschichte schildern.
Die ungewöhnliche Erzählperspektive zieht die Leser:innen sogleich in eine verschwörerische Beobachterrolle: als würde man zuweilen selbst Teil einer Wesenheit, die »durch den Kamin« oder durch »eine Ritze zwischen den Schindeln« verschwindet, um die ganze Szenerie noch einmal aus einer anderen Position zu betrachten und etwa »aus der Entfernung, aus der Höhe herabzuschauen«. Auch der sensible Wojnicz spürt deutlich die Gegenwart dieses »nichtmenschlichen« Beobachters.
Im Sanatorium lernt er, neu zu sehen – durch seine Freundschaft mit dem schwerkranken Berliner Studenten der Beaux-Arts, dem Homosexuellen Thilo von Hahn. Der liebenswerte junge Mann lehrt ihn einen »umfassenden, einen totalen, absoluten Blick (…), der das Detail überwindet und zu den Fundamenten einer bestimmten Ansicht, einer grundlegenden Idee führt, ohne die Einzelheiten, die unseren Blick und Verstand immerzu ablenken«. Allmählich begreift Wojnicz, dass er nach einem radikalen Perspektivwechsel »etwas gänzlich anderes sehen würde«.
Doch erst einmal trifft er den Besitzer des Gästehauses, Wilhelm Opitz – und Doktor Semperweiß, der daran glaubt, dass die »Anomalie, das Schwache, das Verleugnete in uns«, den Menschen ausmacht. Bis zuletzt weigert sich Wojnicz, sich vor ihm vollständig zu entblößen. Mehr und mehr erhärtet sich der Verdacht, er könnte ein Hermaphrodit sein, auch andere Verhaltensweisen scheinen darauf hinzudeuten.
Bereits einen Tag nach seiner Ankunft hat Wojnicz die Leiche von Klara Opitz, der Frau des Gästehausbesitzers, auf dem Esstisch vorgefunden – angeblich Selbstmord. Daraufhin beginnt er, nachts heimlich in das Zimmer der Verstorbenen zu schleichen. Dort findet er zu seinem Entsetzen eine Art Folterstuhl vor; dennoch kehrt er immer wieder zurück und schlüpft auch gern mal in die Schuhe und Kleider der toten Frau.

Später erfahren wir, dass Wojnicz’ Mutter früh verstorben ist und das Kind deshalb von einer gutherzigen Haushälterin mitbetreut wurde. Dann aber übernahm sein strenger Vater komplett das Regiment, trieb dem zarten Kind endgültig das Weinen aus und nötigte es beispielsweise des Öfteren, eine vom Blut einer frisch geschlachteten Ente strotzende Suppe zu löffeln, schließlich wolle man »nur das Beste für ihn; damit ein echter Mann aus ihm würde«. Der Patriarch schärft ihm ein: »Weib und Kröte tun nicht Gutes kund, sind mit dem Teufel als Dritten im Bund.«
Auch im Sanatorium entkommt Wojnicz den patriarchalen Gepflogenheiten der damaligen Zeit letztlich nicht; gemeinsam mit den männlichen Mitpatienten wird er später sogar unwissentlich ein ähnlich makabres Mahl wie die Entensuppe verspeisen: »Angstel« – ein traditionelles Gericht aus zu Tode erschrockenen Hasenherzen!
In der Männerrunde, die sich selbstgefällig über Gott und die Welt streitet, herrscht über eines weitgehende Einigkeit: die Minderwertigkeit von Frauen. Das gilt für den katholischen Traditionalisten Longinus Lukas aus Königsberg (» … das Gehirn des Weibes ist, wie objektive Forschungen ergeben haben, schlicht und ergreifend kleiner … «) ebenso wie für seinen politischen Gegenpart, den sozialistischen Philologen August August (»Die Psyche der Frauen funktioniert anders als die der Männer. Eine Entwicklung, wie wir sie kennen, ist ihnen fremd«). Diese beiden Männer, die um Wojnicz’ Aufmerksamkeit buhlen, lassen an Naphta und Settembrini aus dem »Zauberberg« denken. Auch Walter Frommer, Theosoph und Geheimrat aus Breslau, kann kaum an sich halten, mitzuteilen: »Wo beim Mann der Sitz des Willens ist, befindet sich bei den Frauen die Begierde.«
Zwar freut man sich, dass Tokarczuk diesen Männern so schön alberne Namen verpasst hat, ein wenig erschöpfend ist es aber schon, immer wieder seitenweise zutiefst sexistische Litaneien über sich ergehen lassen zu müssen. Wenn man jedoch im Nachwort liest, dass es sich bei den im Roman geäußerten misogynen Ansichten um Paraphrasen von Augustinus, William S. Burroughs, Charles Darwin, Jack Kerouac, Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, Shakespeare, Yeats und dem Antisemiten und Frauenhasser Otto Weininger handelt, erfasst einen wieder einmal die überlebensnotwendige Wut über die Jahrhunderte währende physische und psychische Unterdrückung der Frau.
Da erscheint es beinahe schon gerecht, dass Jahr um Jahr im Wald bei Görbersdorf ein Mann in Stücke gerissen wird. Das erinnert, nebenbei gesagt, an den Schneetraum aus dem »Zauberberg«, in dem zwei zottelhaarige Weiber ein Kind zerfleischen. Der schlesischen Legende nach sind alle Frauen des Dorfs nach einer Hexenjagd im 17. Jahrhundert in die Wälder geflohen und nie zurückgekehrt. Aus Rache holen sie sich jedes Jahr im November ein neues Opfer – in letzter Zeit mit Vorliebe aus dem Kreis der schwerkranken Kurgäste.
Wie die Sache ausgeht, muss man in dem unbedingt empfehlenswerten Schauerroman dieser außergewöhnlichen Schriftstellerin selbst nachlesen. »Die Welt«, bekräftigte Olga Tokarczuk in Stockholm, »besteht aus Worten. Die Art und Weise, wie wir über die Welt denken, und, was vielleicht noch wichtiger ist, wie wir über sie sprechen, ist von großer Bedeutung. Was nicht erzählt wird, hört auf zu existieren und stirbt.«
Olga Tokarczuk: Empusion. Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte. Aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. Kampa-Verlag, Zürich 2023, 384 Seiten, 26 Euro

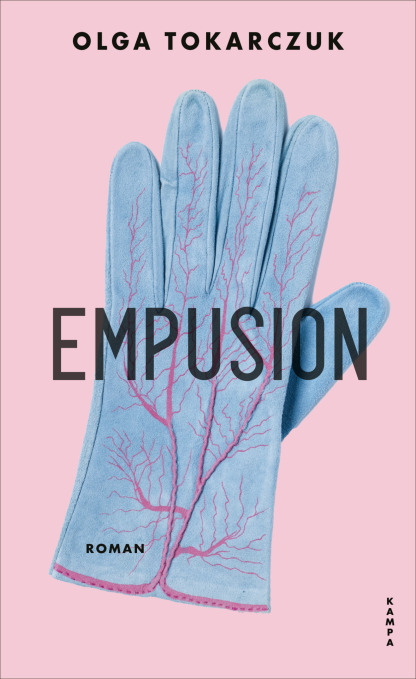






 Die Katzen des Louvre
Die Katzen des Louvre
