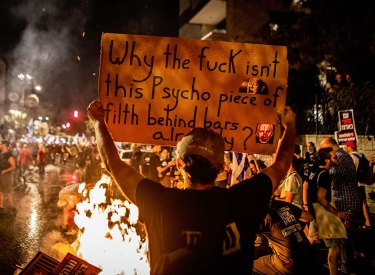Rüsten und sparen
Sie galten lange Zeit als sakrosankt, ein Verstoß gegen die Stabilitätskriterien wurde fast mit dem Ende der Union gleichgesetzt. Nur ihre strikte Einhaltung könne garantieren, dass der Euro nicht wie Butter in der Sonne schmilzt, hieß es. Von solchen Sprüchen ist heute nicht mehr viel zu hören. Die andauernde Wirtschaftsflaute und die enormen Haushaltsdefizite haben dazu beigetragen, dass vor allem Frankreich und Deutschland die Kriterien mehr und mehr in Frage stellen.
Auf dem EU-Gipfel in Porto Karras hat nun der französische Staatspräsident Jacques Chirac wieder laut darüber nachgedacht, den Pakt weiter zu lockern. Doch ihm geht es nicht darum, zusätzliche Schulden für neue Beschäftigungsprogramme aufzunehmen, wie es viele Kritiker schon seit langem fordern.
Vielmehr findet er Gefallen an einem ganz anderen Vorschlag. Schon vor einigen Wochen hatten die französische Verteidigungsministerin Michele Alliot-Marie und ihr deutscher Kollege Peter Struck eine deutliche Erhöhung der Rüstungsausgaben verlangt. Um sie zu finanzieren, müssten die EU-Staaten deutlich mehr Kredite aufnehmen, was wiederum mit den Stabilitätskriterien nicht vereinbar ist. Beide Minister fordern daher, militärische Investitionen künftig von der Berechnung der Defizitgrenze auszunehmen. Dann könnte der Rüstungsetat erhöht werden, ohne die Stabilitätsgrenzen zu belasten. Auch der italienische Verteidigungsminister hatte sich dieser Forderung angeschlossen.
Während es bislang von den europäischen Finanzministern vehement abgelehnt wird, hat nun in Porto Karras zum ersten Mal ein wichtiger Regierungschef der EU dieses Vorhaben unterstützt. Jacques Chirac weiß, wovon er spricht. Mit dem Entwurf einer Sicherheitsdoktrin haben die Europäer auf dem Gipfel die halbe Welt zur »roten Zone« und damit zum Ziel möglicher Interventionen erklärt. So soll außerdem die brach liegende Wirtschaft durch Rüstungskeynesianismus angekurbelt werden. Die Doktrin ergibt aber nur einen Sinn, wenn die Union in der Lage ist, ihre Interessen notfalls auch durchzusetzen. Wegen der militärischen Einsätze in Afghanistan, auf dem Balkan und seit kurzem auch in Afrika sind ihre Kapazitäten aber bereits voll ausgeschöpft.
Und weitere Interventionen werden folgen. So war das europäische Gipfeltreffen noch nicht zu Ende, da befand sich der erste EU-Außenminister in spe, Joseph Fischer, schon auf dem Weg nach Jordanien. Während in Porta Karras noch über die neue Sicherheitsdoktrin der EU gesprochen wurde, machte Fischer auf dem Weltwirtschaftsforum in Sannueh klar, dass auch der Nahe Osten zu den »roten Zonen« gehört, in denen die Europäer künftig für Ordnung sorgen möchten. Eine Beteiligung deutscher Truppen an einer »Friedensmission« in der Region lehnte er zwar noch ab. Doch er ließ auch keinen Zweifel aufkommen, dass sich die EU an einer möglichen Intervention beteiligen werde.
Es ist wohl kein Zufall, dass zur gleichen Zeit Verteidigungsminister Struck in Berlin verkündet, dass der deutsche Rüstungsetat in den nächsten vier Jahren um 800 Millionen Euro steigen werde. Dabei wird es nicht bleiben. Bei ihrem Treffen Ende April in Luxemburg hatten die Initiatoren einer schlagkräftigen EU-Armee, allen voran Chirac und der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, bereits angedeutet, dass sich die europäischen Verteidigungsausgaben im Laufe der nächsten zehn Jahren verdoppeln müssten, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. In Porto Karras hat Chirac gezeigt, wie es funktionieren könnte.