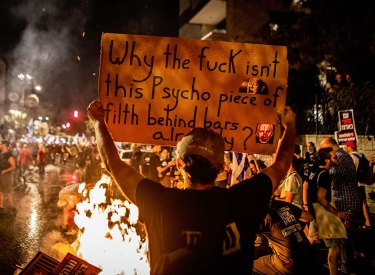Die zweite Chance
Der Glanz des Neuen ist unterwegs verloren gegangen, doch Labours Sieg bei den Unterhauswahlen am Donnerstag dieser Woche scheint trotzdem sicher. Vier Jahre nach dem Triumph von 1997 wird Anthony Blairs Labour-Partei wohl das historische Novum einer zweiten Amtszeit in Folge erreichen. Nur eine niedrige Wahlbeteiligung könnte die Mehrheit von 179 Mandaten im House of Commons nennenswert schrumpfen lassen. Labour tat sich im Wahlkampf schwer, den Wählern zu erklären, warum ihre Stimme überhaupt zählen könnte.
Vor vier Jahren konnte New Labour auf der Welle des Cool Britannia gleiten, eines neuen nationalen Selbstbewusstseins, das sich in der Young British Art (YBA) und im Britpop zum Ausdruck brachte. Nach jahrelanger Rezession und harten sozialen Auseinandersetzungen hatte sich die Gesellschaft erneuert und New Labour schien diese Innovation politisch umsetzen zu können. Inzwischen ist die einst provokative YBA musealisiert worden und die Bezeichnung Britpop eine Beleidigung.
Der in vier Jahren sichtlich gealterte Blair versucht stattdessen, im Wahlkampf an den modernisierten Patriotismus anzuknüpfen, indem er sich dem Lieblingsthema der konservativen Tories widmet: der Europäischen Union und dem Euro. Die Konservativen machen aus ihrem Wahlkampf eine Kampagne zur Rettung des britischen Pfunds, um die Wahl in ein vorgezogenes Referendum über den Beitritt zur Währungsunion umzuwandeln.
Außerdem kündigte Parteichef William Hague an, den EU-Vertrag von Nizza neu zu verhandeln, um Großbritanniens Vetorecht zu erhalten. »Isolation in Europa ist nicht patriotisch, sondern die Verleugnung unseres wahren nationalen Interesses«, konterte Blair. Europa stelle eine »einmalige Gelegenheit für Einfluss und Führerschaft auf der Weltbühne in vitalen Fragen unseres nationalen Interesses dar. Wahrer Patriotismus heißt zuerst Aufstehen für das britische nationale Interesse.«
Tatsächlich ist die Haltung zur EU neben der Steuerpolitik der einzige nennenswerte Unterschied zwischen den beiden großen Parteien, und die Kampagnen für das Referendum zum Euro-Beitritt, das nach Blairs Meinung innerhalb der nächsten zwei Jahre stattfinden soll, haben schon jetzt begonnen. Doch vor allem bei den klassischen Tory-Themen Einwanderung, Kriminalität und Wirtschaft hat Labour sich so weit nach rechts bewegt, dass die Konservativen extremistische Positionen einnehmen mussten, um sich überhaupt noch profilieren zu können.
Insgesamt war Labours erste Amtszeit von der Suche nach einem breiten Konsens und vom Bemühen um Zustimmung in den Meinungsumfragen geprägt. Der »Dritte Weg« bestand offenbar darin, möglichst vielen politischen Richtungen gefallen zu wollen. Dementsprechend wechselten sich linke und rechte Politik ab: Labour führte einen Mindestlohn ein und erhöhte die sozial ungerechten indirekten Steuern. Die Arbeitslosigkeit sank unter die magische Millionengrenze, während Unternehmer die flexiblen Kündigungsschutzgesetze als Druckmittel gegen Arbeitnehmer verwenden konnten. Die Kinderarmut wurde reduziert, doch die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich noch weiter geöffnet. Die EU-Menschrechtscharta wurde unterzeichnet und gleichzeitig ein entwürdigendes Gutscheinsystem für Asylbewerber eingeführt. Schottland und Wales erhielten Regionalparlamente, aber das Mehrheitswahlrecht wurde nicht wie 1997 angekündigt reformiert.
Die dringendste Aufgabe, die Sanierung der wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen, wurde allerdings nicht bewältigt. Deshalb bittet Blair nun um eine »zweite Chance«, um, wie es im Wahlprogramm heißt, einen »öffentlichen Dienst von Weltklasse« zu schaffen. »Ich denke, dass der Abriss der Barrikaden zwischen öffentlichem, privatem und freiwilligem Sektor weitergehen wird«, erklärte Blair dem Observer. »Wir müssen die ermüdende Wahl zwischen altmodischem Sozialismus und Ultra-Thatcherismus durchbrechen.«
Bei den anstehenden Reformen im Bildungs- und Gesundheitswesen geht es vorerst nicht um traditionelle Privatisierungen, wie sie in der Gas- und Wasserversorgung oder der Telekommunikation von den Tories durchgesetzt wurden. Das staatliche Gesundheitswesen, der National Health Service (NHS), der aus Steuermitteln finanziert wird und allen Einwohnern kostenlose Behandlung garantiert, ist bereits seit einigen Jahren ein Experimentierfeld. Die meisten Senioren- und Behindertenheime und viele psychotherapeutische Einrichtungen werden privat geführt, öffentliche Krankenhäuser wurden mit privatem Kapital gebaut, und der NHS bezahlt jährlich mindestens 120 Millionen Euro für Operationen in privaten Hospitälern, um das Versprechen einer Verkürzung der Wartelisten für Operationen ansatzweise einzulösen.
Labour möchte in den nächsten fünf Jahren 10 000 Ärzte und 20 000 Krankenschwestern einstellen, die zum Teil im Ausland angeworben werden sollen. Außerdem soll privates Management eingeführt und mit Hilfe privaten Kapitals ein Programm zum Neubau von Krankenhäusern durchgeführt werden. Die Dienstleistungen wären für die Patienten dann weiterhin kostenlos und würden vom NHS bezahlt. Labour behauptet, der öffentliche Dienst sei zu unbeweglich, weshalb die »Effizienz« des privaten Sektors genutzt werden müsse.
»Die Höhe der Finanzierung ist falsch, nicht die Struktur«, argumentiert hingegen Christine Hancock, die Generalsekretärin der größten Pflegepersonalgewerkschaft Royal College of Nursing. »Es gibt keine Hinweise, dass privates Management effizientere oder sogar bessere Gesundheitsleistungen hervorbringen kann.«
Die NHS-Angestellten waren vor allem wegen einer im Wahlkampf »vorzeitig durchgesickerten« Studie des einflussreichen, der Labour Praty nahe stehenden Institute for Public Policy Research (IPPR) beunruhigt; darin wird die weit gehende Privatisierung von zentralen Bereichen des NHS empfohlen. Hancock kritisierte auf einem Treffen ihrer Gewerkschaft diese Pläne und verwies auf die Erfahrungen mit Privatiserungen in der Langzeitpflege: »Zuerst schien alles großartig. Dann begann der Druck der Kostenkontrolle - unzureichende Personalausstattung und Diagnosemöglichkeiten. Wir werden nicht zulassen, dass noch mehr unserer Patienten diesem Schlamassel und diesen Ungerechtigkeiten ausgesetzt werden.«
Das Bildungssystem ist das Kernstück der Vision von einer Leistungsgesellschaft, die »Gleichheit der Chancen« garantieren und soziale Ungleichheiten überwinden soll. Vor allem die Gesamtschulen in verarmten innerstädtischen Bereichen sollen besser ausgestattet werden. Der derzeitige Bildungsminister David Blunkett verspricht wesentlich mehr Geld und Lehrer.
Zudem soll es künftig »neue Spezialisierungen in den Bereichen Business und Wirtschaft, Naturwissenschaft und Ingenieurwesen geben, die zu den bestehenden in Technik, Kunst und Sport hinzukommen«, erklärte er bei der Vorstellung des Bildungsprogramms seiner Partei. Sollte, wie in der IPPR-Studie vorgeschlagen, privates Kapital auch im kostenlosen staatlichen Bildungswesen eingesetzt werden, könnte die Führung ganzer Schulen an Privatfirmen übertragen werden: der Staat bezahlt die Management-Firmen statt die Bücher und Lehrer. So könnte sich die Privatwirtschaft ihren Nachwuchs heranzüchten und daran auch noch verdienen. Es gäbe jedoch vorerst »keine Ziele und keine Grenzen« für private Investoren in diesem Bereich, so Blunkett.
Auch für die Universitäten hat Labour Pläne: bis 2010 soll die Hälfte der Einwohner unter 30 Jahren einen Hochschulabschluss besitzen. Doch gerade ökonomisch Benachteiligte schrecken angesichts der von Labour in England und Wales eingeführten Studiengebühren und der abgeschafften Zuschüsse vor einem Studium zurück. »Das ist eines der Dinge, die wir nicht hätten tun sollen«, beurteilte nach Angaben des Sunday Telegraph selbst die ausscheidende Kabinettsministerin Mo Mowlam Labours Bilanz. Die bisherige Politik hat Schulden von 15 000 Euro plus Zinsen am Ende eines dreijährigen Studiums zur Normalität werden lassen.
Labours New Britain wird vor allem dem privaten Sektor neue Profitmöglichkeiten eröffnen, indem Steuergelder an Aktienbesitzer weitergeleitet werden. Falls die versprochene Modernisierung erfolgreich sein und die Konjunktur stabil bleiben sollte, könnte Labour sogar auf eine dritte Amtszeit hoffen.