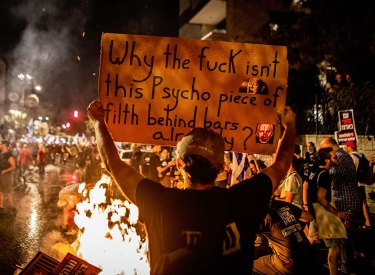Magere Zeiten
Manchmal reagiert die EU ganz schnell - wie nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) auf ihrem Territorium. Seither darf an den Grenzen wieder kontrolliert werden. Butterbrote aus England werden konfisziert, Schüleraustauschprogramme gestoppt, Ferien auf dem Bauernhof storniert. Bei der Tierschau im Zirkus dürfen die Vierbeiner nicht mehr angefasst werden, und der Verband der verbeamteten Tierärzte in Deutschland fordert eine Seuchen-Task-Force.
»Touristen werden genötigt, ihre Schuhe in eine schmutzige Brühe zu tauchen, und dürfen dann mit den Autos weiterfahren, an deren Pedalen der Dreck vermutlich weiterhin klebt«, schreibt die konservative tschechische Tageszeitung Lidove noviny. Diese Maßnahmen seien in erster Linie »fürs Auge gedacht«, sagt dazu der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europäischen Parlament, Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf. Die aktuelle Situation mache deutlich, »dass es offensichtlich keine ausgearbeitete Krisenstrategie in Europa gibt«.
»Früher haben wir eine kranke Kuh isoliert und gewartet, bis sie wieder gesund wurde«, so der lapidare Kommentar eines älteren Landwirts, der andere Zeiten kennt. Früher war vieles einfacher. Und die Lösungen waren notgedrungen pragmatischer. Notschlachtungen kamen nicht in Frage. Immerhin waren die meisten Tiere nach wenigen Fiebertagen wieder wohlauf, in der Regel sterben nur fünf Prozent der erwachsenen Tiere an MKS. Isolieren oder die Herde bewusst durchseuchen, war deshalb das altbewährte Rezept.
Eine Strategie, die heute mit großen Verlusten verbunden wäre: Nicht nur, dass erkrankte Tiere noch monatelang weniger fressen und weniger Milch geben. Die hohe Viehdichte in vielen Regionen Europas verleiht den hochansteckenden Picornaviren eine explosive Kraft. Rinder können immerhin bis zu zwei Jahre lang Träger des Virus sein. Dazu kommen die Spielregeln der modernen Agrarwirtschaft, die den weltweiten Tiertourismus deutlich haben anwachsen lassen. Heute herrscht die Spezialisierung auf den Höfen: Während die einen Kälber oder Ferkel züchten, mästen andere sie, halten Milchkühe oder betreiben Bullen- bzw. Schweinemast. Kein Wunder, wenn die alten Methoden der Tierhygiene nicht mehr funktionieren.
Auch moderne Erkenntnisse sind manchmal schnell überholt. »Blut- und Fleischfuttermehle enthalten hohe Rohproteinmengen von guter Qualität«, gibt der Münchner Professor Manfred Kirchgeßner in seinem Standardwerk »Tierernährung« angehenden AgraringenieurInnen als Tipp für die Schweinemast mit auf den Weg.
Für Kirchgeßner und seine Kollegen geht es vor allem darum, exakte Berechnungen aufzustellen. Leistungsbedarf und umsetzbare Energie sind die entscheidenden Parameter, um die optimale tägliche Futterration zusammenzustellen. Zermahlene Tierkadaver stehen seit BSE in Europas Ställen nur noch selten auf dem Speiseplan.
Dennoch grenzt es fast schon an ein Wunder, dass es nicht schon früher zu einem MKS-Import in die EU kam. Denn die Seuche ist in den vergangenen Jahren wiederholt in Osteuropa aufgetreten, ein sogenannter MKS-Gürtel zieht sich von China über Indien, den Nahen Osten und Afrika bis nach Südamerika. »Die Tiere in Afrika oder Indien bekommen die MKS, wie bei uns die Kinder Masern oder Röteln durchleben«, schreibt Susan Boos vom Schweizer Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe in der Woz.
Nicht so in Europa. Hier war 1992 beschlossen worden, die Politik der absoluten Seuchenfreiheit zu verfolgen. Da es zu diesem Zeitpunkt auf dem Territorium der EU keine Fälle von MKS gab, wurden Impfungen kurzerhand aus ökonomischen Gründen verboten. Denn Japan, die USA oder Korea importieren kein Fleisch von geimpften Tieren, weil sauberes nicht von infiziertem Fleisch unterschieden werden konnte. Dazu kommt, dass auch gesunde, geimpfte Zuchtbullen das Virus weitergeben können.
Somit bevorzugte es die EU, mit dem generellen Impfverbot das Risiko eines Virus-Imports in Kauf zu nehmen. Immerhin war es unmöglich, den Personen- oder Warenverkehr aus Regionen einzustellen, in denen die Seuche aufgetreten war. Man vertraute auf die neue Strategie im Fall eines Ausbruchs: notschlachten und verbrennen.
Dass dieser Plan in modernen Agrarstaaten an seine Grenzen stößt, zeigt das Beispiel Großbritannien. Obwohl mittlerweile 170 000 Kühe, Schafe und Schweine auf der britischen Insel getötet wurden, breitet sich die Seuche weiter aus. »Bei den hohen Tierkonzentrationen dauert das Abschlachten zu lange, eine Notimpfung ist daher dringend notwendig«, heißt es in einem Bericht des unabhängigen Elm Farm organic research centre.
Das Zentrum will das Schlachtprogramm der EU vor Gericht anfechten. Auch deutsche Bauern wollen per Gerichtsentscheid eine Schutzimpfung erzwingen. »Die geimpften Tiere müssten auch nicht unbedingt notgeschlachtet werden«, empfiehlt Graefe zu Baringdorf. »Der Fleischverzehr ist ja für den Menschen unbedenklich.« Auf dem Weltmarkt wäre die Ware allerdings unverkäuflich.
Die EU-Kommission bleibt jedoch vorerst hart. In einer Sondersitzung beriet der Ständige Veterinärausschuss am vergangenen Freitag lediglich über eine eingeschränkte Zulassung für Notimpfungen in besonders gefährdeten Gebieten. Immerhin können die EU-Behörden auch in Krisenzeiten mit Erfolgen aufwarten. Denn die Suche nach dem Schuldigen scheint ein Ende zu haben: Ein illegaler Fleischimport aus Asien habe die Seuche nach Großbritannien eingeschleppt, hieß es in britischen Medien.
Hier schließt sich einer der vielen Tierkreise: Im Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Südkorea hatte die EU eine Chance für den eigenen, BSE-gebeutelten Fleischmarkt gesehen. Als im vergangenen Jahr Südkorea wegen MKS als wichtiger Schweinefleischlieferant ausfiel, stiegen die Weltmarktpreise. Dadurch wurde, genau wie durch die Schwäche des Euro, die EU-Haushaltskasse entlastet; die exportierenden EU-Bauern konnten höhere Preise kassieren, und die Union musste ihnen einen geringeren Ausgleich zahlen.
Nun aber freuen sich andere. Dank MKS konnten Groß-Exporteure wie die USA ihre Grenzen für europäisches Rind- und Schweinefleisch schließen. Gegen dieses Wiederaufleben des Protektionismus protestierte die EU. David Byrne, der EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz, kündigte Mitte März vor dem Europaparlament an, die Kommission wolle dafür sorgen, dass »überzogene Reaktionen zurückgenommen werden«.
Derweil handelt auch Europa. Erst vor zwei Wochen sprach sich etwa der Ständige Veterinärausschuss der EU für einen Stopp der Einfuhr von Frischfleisch aus Argentinien aus. »Die MKS-Lage in diesem Land ist unklar«, heißt es in einer Erklärung vom 14. März. Bislang durften aus Argentinien kontrollierte Fleischprodukte importiert werden.
An anderer Stelle wird jedoch die EU in Sachen Maul- und Klauenseuche künftig mehr Toleranz an den Tag legen müssen. Denn auch das gebietet die Ökonomie: Die Ost-Erweiterung der Europäischen Union wird möglicherweise dafür sorgen, dass die Seuche präsent bleibt. Die Vision eines seuchenfreien Europa dürfte schon deswegen eine Illusion sein.