Zwischen Subkultur und »Normalität«
Keine Revolutionäre
Statt Homosexuelle zum umstürzlerischen Subjekt zu erklären, interessierten sich Martin Dannecker und Reimut Reiche für das Alltagsleben von Schwulen – und auch dafür, wie sich darin internalisierte Homophobie zeigt.
Von Benedikt Wolf
»›Normal‹ ist aber das, was unter heterosexuell firmiert, bestenfalls in einem statistischen Sinne.« Dieser Satz, der in Martin Danneckers und Reimut Reiches 1974 erschienener Studie »Der gewöhnliche Homosexuelle« steht, war Mitte der siebziger Jahre eine Provokation. Nicht nur galt es als gesichert, dass die Heterosexualität in einem eben nicht nur statistischen, sondern auch normativen Sinne die »normale« Sexualität ist. Das Normale selbst galt der Nachkriegsbundesrepublik als grundlegend für die Stabilität der Gesellschaft und ihre angeblich seit langem überlieferten Werte. Dieser etablierten Meinung widersprach die Studentenbewegung, die die »Normalität« als geronnene historisch gewachsene Herrschaftsverhältnisse begriff – auch in Bezug auf Geschlecht und Sexualität.
Ab 1968 begann sich eine linke Frauenbewegung zu formieren und 1971 war Dannecker an Rosa von Praunheims Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« beteiligt, der zur Entstehung einer westdeutschen Schwulenbewegung führte. Gemeinsam mit Reiche, der in die Geschichte des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds als dessen vorletzter Vorsitzender einging und zur Debatte um die Sexualität mit »Sexualität und Klassenkampf« 1968 einen gewichtigen Beitrag geleistet hatte, ging er mit der großangelegten empirischen Studie den Weg in die akademische Forschung und Theoriebildung.
Was an der Studie neu war, lässt sich unter anderem im Vergleich mit der Forschung des bis dahin bedeutendsten bundesdeutschen Sexualwissenschaftlers ablesen: Hans Giese. Dieser, während des Nationalsozialismus Mitglied der NSDAP und Heidegger-Hörer, in den späten Sechzigern mit der APO sympathisierend, hatte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, die Homosexuellenbewegung der Vorkriegszeit wiederzubeleben, und sich dann im Bereich der Sexualwissenschaft auf Argumentationen verlegt, die zwischen gebundenen und ungebundenen Homosexuellen unterschied und Erstere auf Kosten der Letzteren idealisierend aufwertete. Dabei hatte er sich öffentlich nicht als homosexuell zu erkennen gegeben.
Die Autoren werfen der bisherigen Homosexualitätsforschung Grundsätzliches vor
Mit dieser Art der Sexualforschung brach »Der gewöhnliche Homosexuelle«. Dort heißt es lapidar: »Einer der Autoren (Dannecker) ist homosexuell.« Der Satz steht im Rahmen der Erläuterung des methodischen Ansatzes der Studie und hat dort den Wert eines Arguments: Persönliche Betroffenheit könne zwar nicht für analytische Durchdringung bürgen, doch die begriffliche Verarbeitung der persönlichen Erfahrungen in der Subkultur – zweifellos ist hier Danneckers Arbeit in der Frankfurter Gruppe Rote Zelle Schwul (RotZSchwul) mitgemeint – habe die Voraussetzungen für die Erhebung und Interpretation des Datenmaterials geschaffen.
Die beiden Autoren werfen der bisherigen Homosexualitätsforschung Grundsätzliches vor: der psychoanalytischen Forschung oftmals schwulenfeindliche theoretische Vorannahmen, deren empirische Überprüfung noch nicht einmal versucht werde; der soziologischen Forschung »begriffsloses Ausschwitzen des Materials, stumpfsinniges Korrelieren von allem mit jedem« und ein verdinglichtes Verhältnis zu Theorie, die als »Ansatz« dem empirischen Material übergestülpt werde.
Dem setzen die Autoren den materialistischen Anspruch entgegen, »das empirische Material und die herrschenden Gedanken und Theorien über Homosexualität und Homosexuelle beständig miteinander zu konfrontieren«. Die Kritik an Psychoanalyse und empirischer Sozialforschung bedeutet hier keineswegs deren Ablehnung. Vielmehr machen Dannecker und Reiche in ihrer Studie vor, dass das eine nicht ohne das andere geht.
Dannecker und Reiche sind weit davon entfernt, einen vermeintlichen revolutionären Charakter der Homosexualität herauszupräparieren und zu idealisieren.
Anders als etwa Guy Hocquenghem, die zentralen theoretischen Figur der französischen radikalen Homosexuellenbewegung, in seinem zwei Jahre vorher erschienenen Buch »Das homosexuelle Begehren« sind Dannecker und Reiche weit davon entfernt, einen vermeintlichen revolutionären Charakter der Homosexualität herauszupräparieren und zu idealisieren. Sie interessieren sich vielmehr für die Masse der gewöhnlichen Homosexuellen, der sie auf – verglichen mit dem damaligen Forschungsstand – imposanter Datengrundlage näherkommen. Wo Hocquenghem von einer »Auflösung der sublimierenden Phallus-Hierarchie« phantasiert, die ein Zusammenschluss der Homosexuellen herbeiführen könne, kritisieren Dannecker und Reiche die Strukturen der Subkultur und die kollektive Neurose der Homosexuellen scharf – den verdinglichten Umgang miteinander und den neurotischen Selbsthass.
Danneckers und Reiches Begriffe sind allerdings so gebaut, dass sie die zum Teil durchaus vehemente Kritik an den Homosexuellen durchgehend auf die Kritik der gesellschaftlichen Totalität beziehen: Wenn schwule Subjektivität durch die schwulenfeindliche Gesellschaft deformiert ist, dann ist die Kritik an der schwulen Subjektivität zugleich schon Kritik an der schwulenfeindlichen Gesellschaft. Es ist, so heißt es bei Dannecker und Reiche, »der soziale Zwang, der den Homosexuellen macht, jedenfalls das an ihm, was das ›Andere‹, das ›Abweichende‹ ist, das, wovor Heterosexuelle sich ängstigen und was sie ablehnen – und das, was unter entsprechender Härte des Zwangs auch die Homosexuellen selbst bei sich ablehnen.«
*
Die Pioniere
Seit dem Erscheinen von »Der gewöhnliche Homosexuelle« hat sich viel verändert: Nicht nur die sexuelle Liberalisierung, sondern auch HIV/Aids konnten in der Studie nicht berücksichtigt werden. Was sich seit 1974 zum Guten getan hat – und was nicht.
Von Marco Kammholz
Mit scharfen Urteilen halten sich Martin Dannecker und Reimut Reiche in ihrer bahnbrechenden soziologischen Studie »Der gewöhnliche Homosexuelle« nicht zurück: Homosexuelle Männer würden an einer kollektiven Neurose leiden, sich mit dem heterosexuellen Angreifer identifizieren und in ihrem Freizeit- und Konsumverhalten einem »Zwang zum Erzeugen eines Scheins des Besonderen« unterliegen.
Von vorangehenden Untersuchungen unterscheidet sich die 1974 veröffentlichte Studie in mehrfacher Hinsicht. Die Autoren attestieren Homosexuellen keine Inferiorität, weisen pathologisierende Einschätzungen zur Homosexualität zurück und richten ihre Schrift erkennbar gegen die Kriminalisierung und Diskriminierung sexueller Minderheiten.
Dannecker und Reiche nehmen aber auch keine falsche Rücksicht auf den homosexuellen Mann und seine sich im empirischen Material abbildenden Konflikte. Dieser Forschungszugang erlaubt es nicht nur, dass auf quantitative Erhebungen zu Promiskuität, Analverkehr, Onanie, Perversion und Lohnarbeit ernstzunehmende theoretische und gesellschaftskritische Analysen folgen. Es werden zudem Interpretationen möglich, die sich im heutigen Umgang mit sexualwissenschaftlichen Befunden wohl kaum noch finden lassen.
Dannecker und Reiche nehmen keine falsche Rücksicht auf den homosexuellen Mann und seine sich im empirischen Material abbildenden Konflikte.
So halten die beiden Sexualwissenschaftler über den Zusammenhang zwischen sexueller Wunschvorstellungen und der Anzahl der Sexualpartner fest: »Mit abnehmender Partnerzahl werden die Ideale immer blonder; mit zunehmender Partnerzahl der Penis immer größer.« Dass ein Teil der homosexuellen Untersuchungsgruppe im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft als sexuell deutlich aktiver und enthemmter gelten kann und die Subkultur homosexueller Männer sich dementsprechend strukturiert, daraus machen Dannecker und Reiche keinen Hehl.
Als glücklicher gelten ihnen die promisken Männer derweil nicht, auch weil das der Studie zugrundeliegende psychoanalytische Sexualitätsverständnis einen naiven Zusammenhang zwischen Häufigkeit sexueller Kontakte und sexueller Zufriedenheit ausschließt. Wohl aber deuten die Angaben der Befragten mit sehr hoher Partnerzahl auf einen konfliktärmeren Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung hin. Hohe sexuelle Aktivität geht offenbar mit einem stabileren Selbstwertgefühl einher.
Tabus weitgehend hinweggefegt
Seit dem Erscheinen vor 50 Jahren sind einige Themenfelder hinzugekommen: sexuelle Liberalisierung, HIV/Aids und Internetsexualität. Vieles hat sich seither im Umgang mit Sexualität gesamtgesellschaftlich grundlegend verändert, manches die Schwulen Betreffende ist jedoch auch erstaunlich konstant geblieben. Tabus sind weitgehend hinweggefegt. Partnersexualität ist nicht mehr fest in der Hand der Ehe. Onanie gilt längst nicht mehr als verpönte Ersatzbefriedigung, sondern wird als »Solosex« regelrecht vermarktet.
Die Schwulen indessen onanieren aktuellen Befragungen zufolge immer noch deutlich häufiger als Vergleichsgruppen. Datenerhebungen unter szenenahen homo- und bisexuellen Männern haben ergeben, dass diese mehrheitlich offene Beziehungen führen, weiterhin teils deutlich promisker sind und im Vergleich zu vielen heterosexuellen Paaren ein flexibleres Treueverständnis aufweisen.
Mit dem Aufkommen von HIV/Aids wurden die Folgen mann-männlicher Sexualkontakte zeitweise potentiell tödlich. Bis heute leben homo- und bisexuelle Männer deutlich häufiger mit HIV und müssen sich Gedanken zu Übertragung und Schutz machen. Cybersexuell aktiv sind Schwule wiederum in besonderem Maße und können nicht nur in dieser Hinsicht als avantgardistisch gelten. Mit dem Erfolg der Schwulenbewegung haben sich gleichfalls Männlichkeitsbilder modernisiert, vor allem für die Heterosexuellen.
»Den Homosexuellen dürfte eine Pionier-Rolle vor allem bei der Erschließung der Männer für Märkte und Konsum-Komplexe zukommen.« Dannecker/Reiche
Schon Dannecker und Reiche stellten vorausschauend fest: »Den Homosexuellen dürfte eine Pionier-Rolle vor allem bei der Erschließung der Männer für Märkte und Konsum-Komplexe zukommen, bei denen tiefverwurzelte Exhibitions-Hemmungen und Weiblichkeits-Ängste der Männer zu überwinden sind.« Heutzutage ist die kosmetische, sportliche und ästhetische Arbeit am männlichen Körper längst kein Alleinstellungsmerkmal der Homosexuellen mehr. Anders als in den Siebzigern dürfte derzeit allerdings das öffentliche wie auch das intime Leben schwuler Männer aussehen.
Der »Maskenwechsel hetero-/homosexuell« ist heutzutage zumindest an vielen Orten obsolet geworden. Überraschen dürfte aber, dass sich der Zeitraum zwischen dem ersten sich Bewusstwerden über die eigene Homosexualität und der Kommunikation darüber in den vergangenen fünf Jahrzehnten offenbar nicht entscheidend verändert hat.
Dauer von Coming-out-Prozessen kaum verändert
Dannecker und Reiche kamen 1974 zu dem Ergebnis, derlei Coming-out-Prozesse dauerten durchschnittlich drei Jahre. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2015 stellte fest, bei homo- und bisexuellen Heranwachsenden vergingen zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-out durchschnittlich 2,9 Jahre. Auch unter liberalisierten Vorzeichen scheint die Sexualität schwuler Jungen und Männer gesellschaftlich besonders überformt, zum Beispiel von der Angst vor Liebesverlust durch Familie oder der Gefahr von Mobbing und Gewalt.
Ein gar nicht unwichtiger Unterschied zwischen der Auseinandersetzung mit den Lebenslagen von Schwulen damals und heute könnte im Blick auf die untersuchte Gruppe bestehen. Für die psychoanalytischen Autoren Dannecker und Reiche hatten homosexuelle Männer selbstverständlich Triebkonflikte, der partielle Freiraum ihrer Subkultur galt keineswegs als harmonisch und unschuldig. Heutige Untersuchungen über schwule und bisexuelle Männer hingegen romantisieren häufig eine zur Gemeinschaft verklärte LGBT-Community. Noch dazu münden sie in aller Regel in Schutz- und Handlungsempfehlungen für durch sogenannten »Minderheitenstress« vulnerabel gewordene Queers. Deren sexuellem Wohlbefinden stünden vor allem heteronormative Zumutungen im Wege. Konflikte wirken aber nicht nur in eine Richtung, ließe sich solcherlei Vorstellungen mit »Der gewöhnliche Homosexuelle« entgegenhalten.
***
Am 31. Mai findet in der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin (IPU) ein Gesprächsabend mit Martin Dannecker und Reimut Reiche anlässlich des 50. Jahrestags des Erscheinens von »Der gewöhnliche Homosexuelle« statt.
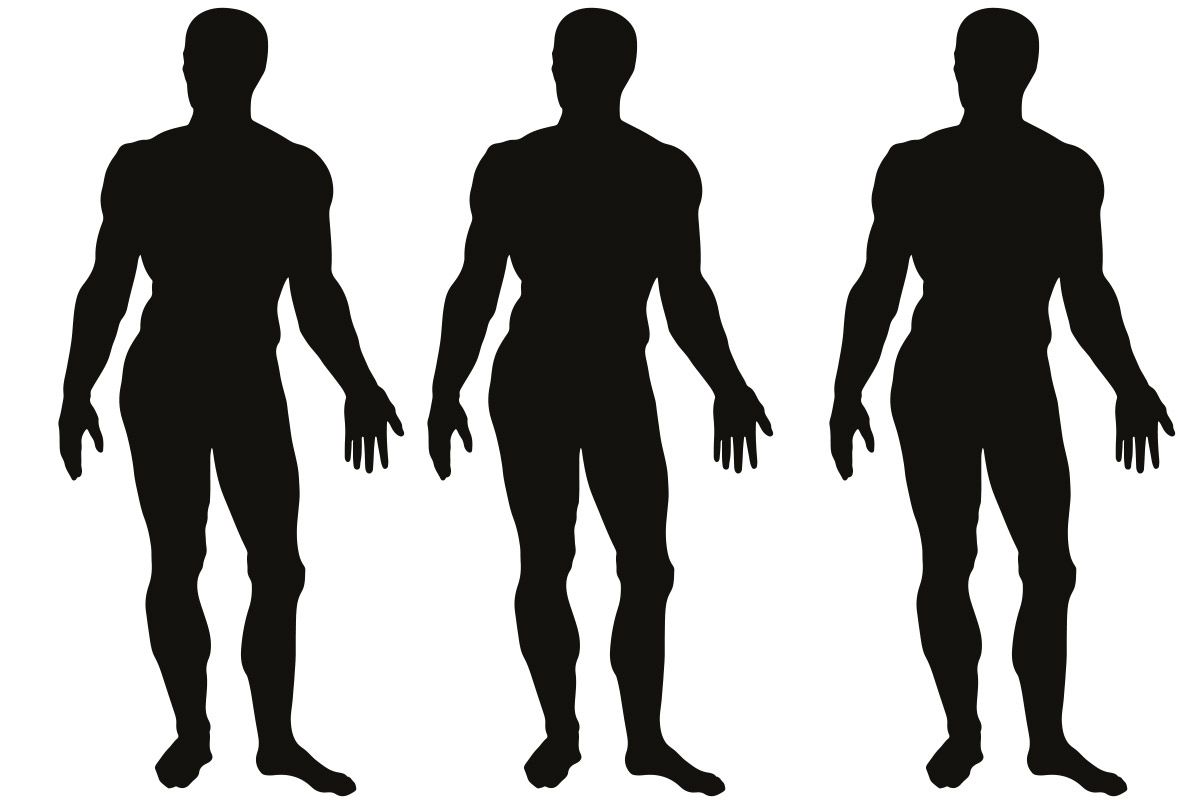
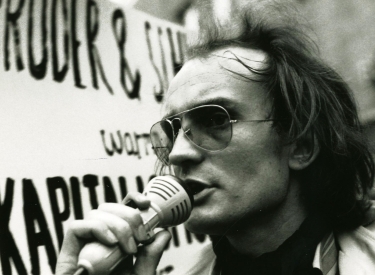
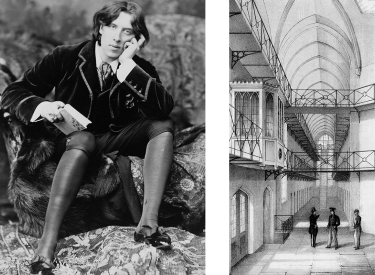






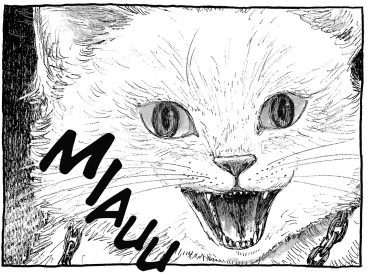
 Die Katzen des Louvre
Die Katzen des Louvre
