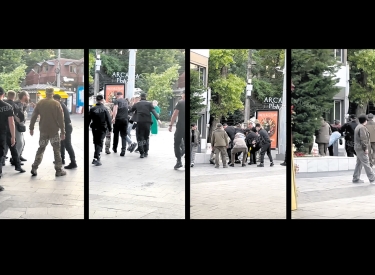Digitale Erstsemester
Studierende sind in der Covid-19-Pandemie zu Monaden geworden. Spätestens seit der europaweiten Bologna-Reform gelten auch deutsche Hochschulen als verschulte, neoliberale Orte der Konkurrenz statt als Stätten des freien Wissenserwerbs und -austauschs – auch wenn dieses Ideal schon vorher nicht viel mit der Realität zu tun hatte. Aber das, was Studierende seit Beginn der Pandemie an den Universitäten erleben, verlangt ihnen individuelle Disziplin und Flexibilität auf einem ganz neuen Niveau ab.
Der Studienanfang ist ein Neubeginn. Viele ziehen bei den Eltern aus, vielleicht in eine Wohngemeinschaft und meist in eine neue Stadt. An der Universität trifft man unbekannte Menschen, geht mit ihnen auf Partys, sieht sich in der Bibliothek oder in der Mensa. Manche engagieren sich in ihrer Fachschaft oder schnuppern in eine der vielen politischen Gruppen hinein, die es an jeder Hochschule gibt. Aber warum ausziehen und das gar in eine fremde Stadt, wenn man die Seminare sowieso nur online besucht, wenn alle Kneipen geschlossen sind und es kaum Gelegenheiten gibt, andere Studierende kennenzulernen? Endlich in einer neuen, oft größeren Stadt wohnen, aber keinen Anschluss finden – so hat man sich das nicht vorgestellt. Doch auch erst einmal nicht umziehen scheint keine Option – zu unklar ist es, ob nicht doch schon das nächste Semester in Präsenz stattfindet. Auch bei den jetzt anstehenden Prüfungen bestehen viele Universitäten auf Präsenz, Termine werden kurzfristig angekündigt und verschoben. Planung und Selbstorganisation werden so ungleich schwieriger.
Wer gutsituiert ist und wessen Eltern studiert haben, der kommt mit der Situation in der Regel besser klar als andere. Manche Eltern, die ihre studierenden Kinder vor der Pandemie unterstützen konnten, können das nun nicht mehr, weil sie ihre Stelle verloren haben oder in Kurzarbeit mussten. Eine bundesweite Studie der Universität Hildesheim zum digitalen Sommersemester 2020 unter mehr als 2 300 Studierenden ergab, dass mehr als 60 Prozent der Befragten finanzielle Unterstützung von ihren Eltern bekommen und mehr als 50 Prozent sich auch über Nebenjobs finanzieren. Beinahe 60 Prozent der Studierenden, die angeben, über weniger Geld als vor der Pandemie zu verfügen, hatten ihren Nebenjob verloren. Eine Studie der Universität Bremen ergab, dass vor der Pandemie etwa drei Prozent der Befragten nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt hatten; im Mai waren es dann knapp 15 Prozent. Existenz- und Zukunftsängste sind keine guten Voraussetzungen für ein Studium. Aber nicht alles ist schlecht: Die längst überfällige Digitalisierung der Universitäten wird jetzt vorangetrieben, und für einige bedeutet es eine Erleichterung, die eigene Zeit freier einteilen zu können. Vor allem für Studierende, die arbeiten, Kinder haben oder Angehörige pflegen, kann das hilfreich sein.
Doch auch das hat zwiespältige Konsequenzen. Studieren ist jetzt sehr individualisiert, für viele spielt sich der ganze Tag in einem Raum ab. Austausch nach den Lehrveranstaltungen gibt es nicht. Studierende loggen sich in digitale Seminarräume ein, häufig hören sie nur zu, während die Professorin redet. So entsteht noch mehr Frontalunterricht als vor der Pandemie. Nach der Veranstaltung schließt die Dozentin den digitalen Raum und damit die Möglichkeit für Austausch und Nachbesprechung. Den Kaffee und die Diskussion nach dem Seminar ersetzt kein Chat.