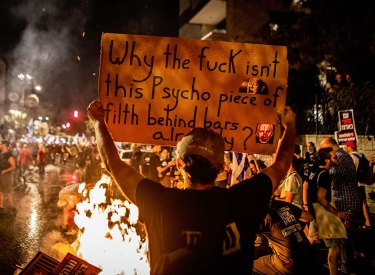A Ken of Goodies
Nicht die Opposition macht dem britischen Premier Anthony Blair derzeit zu schaffen, sondern ein einzelner Abgeordneter, der bis vor kurzem selbst noch Labour-Mitglied war. Seit Ken Livingstone seine Kandidatur als unabhängiger Bewerber für das Amt des Mayor of London bekannt gegeben hat, kündigt sich an, dass die Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt zum Denkzettel für New Labour werden könnte.
Seit einigen Monaten hat die bislang so makellose Fassade von New Labour ein paar deutliche Kratzer. Wenn Livingstone am 4. Mai Bürgermeister von London wird - und dazu hat er gute Chancen - würde er ihr eine dicke Schramme zufügen. Denn mit seiner Bewerbung reagierte Livingstone auf eine Vorwahl, bei der Blair seinen Wunschkandidaten Frank Dobson nur mit Hilfe von Manipulation gegen ihn durchsetzen konnte.
Als Labour im April 1998 das Amt des Londoner Bürgermeisters einführte, erklärte Livingstone prompt seine Kandidatur. Damit verstieß er gegen den erklärten Willen von Staats- und Parteichef Blair. Denn wie kaum ein anderer verkörpert Livingstone »Old Labour»: Als Parlamentarier hat er es sogar gewagt, die von Labour durchgeführten Kürzungen der Sozialleistungen und die Einführung von Studiengebühren zu kritisieren.
Als Gegenkandidat stellten »Tony's Cronies« den damaligen Gesundheitsminister Frank Dobson auf. Um den uncharismatischen Dobson gegen Livingstone durchzusetzen, erwägten sie sogar, Livingstone vom Auswahlverfahren auszuschließen. Öffentlich zeichneten Blair und andere Labour-Spitzenpolitiker die Schreckensvision von einer Rückkehr der ideologischen Grabenkämpfe der achtziger Jahre - und »Red Ken« als deren Personifizierung.
Echte Chancen erhielt »Dobbo« erst durch ein speziell gegen Livingstone konstruiertes Auswahlverfahren für die Kandidaten: Die Stimmen der Londoner Labour-Mitglieder zählen nur zu einem Drittel. Die restlichen Stimmen teilen sich die Labour-Kandidaten für die zu wählende »Greater London Authority«, Labours Unterhaus- und Europa-Abgeordnete mit Wahlkreisen in London und die traditionell mit Labour verbundenen Gewerkschaften. Auf diese Weise konnten die Blair-treuen Abgeordneten Livingstones Vorsprung bei der Basis ausbalancieren. Der linksliberale Guardian merkte an, während in Frankreich das Drei-Stände-System 1789 abgeschafft worden sei, bestehe der Verdienst von New Labour darin, es in Großbritannien erstmals eingeführt zu haben.
Das Ergebnis der Abstimmung war trotz der Manipulation denkbar knapp und kam nur zustande, weil einige Gewerkschafsführungen im Namen ihrer Mitglieder ein »Block Vote« für Blairs Wunschbürgermeister abgaben. »If voting would change anything, they'd abolish it«, heißt ein älteres Buch von Livingstone. Tatsächlich stimmten lediglich 22 275 Labour- und Gewerkschaftsmitglieder für Dobson. Livingstone dagegen erhielt 74 646 Stimmen. Auf Grund der sinnreichen Konstruktion des Wahlverfahrens reichte Dobson dieses Ergebnis aus, um sich zum Kandidaten küren zu lassen.
Das neu geschaffene Direktmandat des Hauptstadt-Bürgermeisters wird eine auf nationaler Ebene bedeutsame politische Plattform darstellen. Und Livingstone hat genug Erfahrung, um eine solche Basis zu nutzen: Von 1981 bis 1986 stand er dem Greater London Council (GLC) vor. In dieser Zeit förderte er Arbeiter- und Frauenrechte, unterstützte Initiativen für ethnische Minderheiten sowie Schwulen- und Lesben-Gruppen und ließ die U-Bahn-Preise reduzieren.
Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen setzte Livingstone Kontrapunkte zur konservativen Regierung Margaret Thatchers: So erklärte er London zur atomwaffenfreien Zone, empfing - was damals noch Sensationswert hatte - Sinn-Féin-Chef Gerry Adams und ließ am GLC-Gebäude ein Banner mit den neuesten Arbeitslosenzahlen anbringen - direkt im Blickfeld der konservativen Regierung. 1986 schafften die Tories den Greater London Council, der ihnen solchermaßen buchstäblich zum Dorn im Auge geworden war, kurzerhand ab. Seitdem werden alle Entscheidungen, die den Großraum London betreffen, auf Regierungsebene getroffen.
Hätte Anthony Blair gewusst, dass er sich mit der Einführung des Amts des Londoner Bürgermeisters ein Problem namens Ken Livingstone ans Bein bindet - wer weiß, ob die Entscheidung jemals so gefallen wäre. Denn fatalerweise verdankt der Favorit seine Popularität bei den Wählern nicht zuletzt dem Unmut über Blairs Strategie, Positionen, die nicht in die schöne neue Labour-Welt passen, einfach abzustrafen.
Jeder Labour-Anhänger hat noch die Wahl zur Nationalversammlung in Wales in Erinnerung, die die Regierung Blair eingeführt hat: Als Labour-Kandidaten für das Amt des »First Secretary« drückte Blair der Basis den farblosen Bürokraten Alun Michael auf - gegen den von der Mehrheit der Parteimitglieder bevorzugten, aber »politisch unzuverlässigen« Abgeordneten Rhodri Morgan. Die Folge war ein für derzeitige Labour-Verhältnisse äußerst unerfreuliches Wahlergebnis und der baldige Rücktritt von Michael. Sein Nachfolger: der ehemalige Gegenkandidat Morgan.
Für viele Labour-Wähler drängen sich die Parallelen zum Fall Livingstone auf. In der Bürgermeisterwahl sehen sie nun die Gelegenheit, gegen den Kontrollwahn von New Labour zu protestieren. Sachthemen spielen dabei eher eine Nebenrolle: Während die Parteiführung versucht, die recht fortschrittliche Politik des GLC unter Livingstone so negativ wie möglich darzustellen, erinnert sich die Mehrheit in erster Linie an seine arbeitnehmer- und minderheitenfreundliche Politik, wie die U-Bahn-Kampagnen »Keep Fares Fair« und »Just the Ticket«.
Livingstone verfügt zudem über ein unbestreitbares Talent im Umgang mit Medien und Menschen: Er wirkt nicht wie ein Berufspolitiker mit Upper-Class-Akzent, sondern scheint die Sprache der Londoner zu verstehen. In der Öffentlichkeit hat »Red Ken« sich zu »Cuddly Ken«, Knuddel-Ken, entwickelt: ein wenig vorlaut und immer für ein Witzchen gut. Dank seines hohen Unterhaltungswerts findet Livingstone auch die Unterstützung zahlreicher Prominenter: von der britischen Comedy-Elite um die einstige »Monty Pythons»-Truppe über DJs wie Fatboy Slim bis zur Popband Blur, mit der er 1995 den Song »Ernold Same« aufnahm.
Der rote Ken spricht vor Londoner Bankern und Managern - und verheimlicht trotzdem nicht seine Sympathie für die Anti-WTO-Proteste in Seattle. Der gekonnte Spagat verschafft ihm die Zustimmung breiter Gesellschaftskreise. Ken kann man, so denken viele, guten Gewissens wählen: Seine Show ist gut, und allzu viel Schaden kann er ohnehin nicht anrichten. Denn auch die Assembly und die britische Regierung haben weiterhin Einfluss auf die Politik in London.
Das bisherige Verhalten der Labour Party hat Livingstone Zustimmungsraten von über 60 Prozent gebracht. Nach dem undemokratischen Auswahlverfahren versuchen Blair & Co. nun, gegen den Unabhängigen die Charakterkarte zu spielen - und wecken damit nur weitere Sympathie für den Dissidenten. Als Livingstone vor wenigen Tagen eine parlamentarische Rüge wegen nicht ausgewiesener Einkünfte erhielt, konnte er problemlos von einer »Labour-Schmutzkampagne« sprechen. Der Hinweis auf die Einnahmen war unter falschem Namen gemacht worden; dahinter steckte ein ehemaliger Mitarbeiter von Dobsons Vize-Kandidaten.