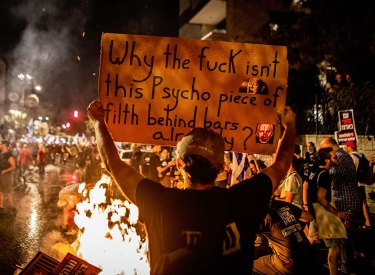Offensive mit Milizen
Dies ist eine allgemeine Offensive, es ist kein Witz." Jean-Pierre Bemba, Chef der Kongolesischen Befreiungsbewegung (MLC) fand vor zwei Wochen die richtigen Worte für die Tatsache, dass Friedensabkommen in der Demokratischen Republik Kongo nur kurz halten. Der Waffenstillstand sei "null und nichtig", erklärte Bemba knapp.
Das Friedensabkommen für den Kongo ist zusammengebrochen. Bereits seit Mitte Oktober rücken Truppen der von Präsident Laurent Kabila geführten Regierung gegen Stellungen des MLC und der beiden Fraktionen des RCD (Kongolesische Sammlungsbewegung für Demokratie) vor, die von Ruanda und Uganda unterstützt werden. Zugleich begannen verbündete Milizen eine Offensive in deren Hinterland.
"Man hofft, dass Kabila keinen allgemeinen Krieg will. Doch er handelt so, als wäre es ihm egal, wenn man entdeckt, dass er den Waffenstillstand verletzt hat", umschrieb am vorletzten Wochenende Amama Mbabazi, ugandischer Minister für regionale Kooperation, dass an drei Fronten gekämpft wird. Auch unabhängige Beobachter gehen davon aus, dass es sich um den Beginn einer Großoffensive der Regierungstruppen handelt. Kabila bestritt, die Kämpfe begonnen zu haben, drohte aber, man werde "schrecklich, aber gerecht" gegen den Nachbarstaat Ruanda vorgehen, "wenn die kongolesische Armee in Kigali steht". Kigali ist die Hauptstadt Ruandas.
Der Kampf um den Kongo ist eine indirekte Folge des Völkermordes in Ruanda und der französischen Militärintervention im Sommer 1994, die einem großen Teil der Hutu-Extremisten den geordneten Rückzug ermöglichte. Um den Terror der Milizen zu beenden, unterstützte Ruanda eine von Kabila geführte Aufstandsbewegung, die sich im Herbst 1996 gegen die Hutu-Extremisten und den mit ihnen verbündeten Mobutu Sese Seko, Kabilas Vorgänger, erhob.
Wegen der Unfähigkeit Frankreichs und der USA, etwas zur Lösung der regionalen Krise nach dem Völkermord beizutragen, hatten afrikanische Staatschefs die Initiative ergriffen. Obwohl der Versuch einer innerafrikanischen Lösung häufig vorgebrachten Forderungen entsprach, hielt sich die Begeisterung der ehemaligen Hegemonialmächte in Grenzen. Der ruandische Vizepräsident Paul Kagame stellte 1997 fest: "Sie stehen nun abseits und werden von allem überrascht. Sie sind darüber sehr verärgert, und sie können es nicht einfach hinnehmen."
Die Chancen für einen politischen Neubeginn wurden nicht genutzt. Nach dem Sturz Mobutus begann Kabila, die Verbündeten Ruandas aus seinem Regime zu verdrängen. Als er den Abzug der ruandischen Truppen aus dem Kongo verlangte, beteiligte sich Ruanda gemeinsam mit Uganda an der Militärrebellion des RCD im August 1998. Nur eine angolanische Intervention verhinderte den Sturz Kabilas. Auch andere afrikanische Staaten schickten Truppenkontingente.
Der RCD spaltete sich in zwei Fraktionen, mit dem MLC entstand eine weitere bewaffnete Oppositionsgruppe. Aber keine von ihnen konnte eine politische Alternative zur Diktatur Kabilas bieten. Uganda und Ruanda haben sich, ebenso wie Angola und Zimbabwe auf Seiten Kabilas, in eine militärische Interventionspolitik verstrickt, die eine politische und ökonomische Eigendynamik entwickelt. Die Interventionsstaaten nutzen die Ressourcen der von ihnen besetzten Gebiete, um ihren Krieg zu finanzieren: Zimbabwes Staatschef Robert Mugabe ließ sich seine Unterstützung für Kabila sogar mit Bergbau-Lizenzen bezahlen.
Die Interventionsstaaten bemühen sich, direkte Konfrontationen zwischen ihren Truppen zu vermeiden, sind aber nicht bereit, ihre Positionen aufzugeben. Der Friedensvertrag, der Mitte Juli dieses Jahres in der sambischen Hauptstadt Lusaka unterzeichnet wurde, enthält daher nur Absichtserklärungen. Vereinbart wurde ein Waffenstillstand, dem der Abzug aller ausländischen Truppen innerhalb von neun Monaten folgen sollte. Eine aus allen Kriegsparteien gebildete Gemeinsame Militärkommission (JMC) soll Verstöße gegen den Waffenstillstand untersuchen, Wege zur Entwaffnung der Milizen finden und für einen "nationalen Dialog" im Kongo sorgen. Dabei war die Kooperation mit einer noch zu bildenden UN-Mission vorgesehen, die Schritt für Schritt die Aufgaben des JMC übernehmen sollte.
Der Sicherheitsrat hat allerdings trotz wiederholter Appelle des UN-Generalsekretärs Kofi Annan und der Kriegsparteien nur die Beobachtermission der Vereinten Nationen für den Kongo (Monuc) genehmigt - ein symbolisches Kontingent von 90 Militärbeobachtern. Völlig vergessen wurde das humanitäre Mandat der Monuc, obwohl nach UN-Angaben zehn Millionen Menschen von der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen bedroht sind. Die Zurückhaltung der "internationalen Gemeinschaft" beruht wohl vor allem auf dem Unwillen von Frankreich und den USA, sich in einer untergeordneten Rolle in einem Konflikt zu engagieren, in dem afrikanische Staaten dominant sind.
Trotz diplomatischer Aktivitäten sind die Chancen, das Friedensabkommen zu retten, gering. Kabila hat die Zeit des Waffenstillstandes genutzt, um die Milizen der Hutu-Extremisten zu reorganisieren und aufzurüsten. Ihre gegenwärtige Stärke wird auf 20 000 bis 25 000 Mann geschätzt. Augustin Bizimungu, ehemaliger Stabschef der ruandischen Armee, koordiniert in Kabilas Generalstab ihre Aktivitäten. Für seine eigenen Truppen hat Kabila trotz Finanznot Waffen für mindestens 250 Millionen Dollar erworben. Angola und Zimbabwe haben ihre Truppenkontingente entgegen den Vertragsbestimmungen aufgestockt - als Rückendeckung für Kabilas Offensive.
Insgesamt verfügt Kabila über etwa 100 000 Soldaten, eine klare Überlegenheit an schweren Waffen und eine kleine Luftwaffe. Die Truppenstärke der Gegenseite dürfte geringer sein, aber diese Soldaten gelten als professioneller und besser motiviert. Zudem kann die Regierungsarmee in den unwegsamen Weiten des Kongo ihre technologische Überlegenheit kaum zur Geltung bringen.
Schon jetzt haben alle Kriegsparteien Schwierigkeiten, die von ihnen angeblich beherrschten Gebiete tatsächlich zu kontrollieren. Eine Vielzahl lokaler Milizen ist entstanden, und die Kämpfe weiten sich wie in der Provinz Ituri auf neue Bevölkerungsgruppen aus: Dort sind seit Mitte Juni mehr als 5 000 Menschen getötet und 100 000 vertrieben worden. Ursprünglich ging es um Landrechte, "aber die Präsenz diverser kongolesischer und ausländischer bewaffneter Gruppen, der leichte Zugang zu Waffen, die kriegsgeschädigte Wirtschaft und die Verbreitung 'ethnischer Ideologien' waren gefährliche Nahrung für die rasche Ausbreitung und Brutalisierung des Konflikts", stellt sogar der UN-Informationsdienst Irin fest.