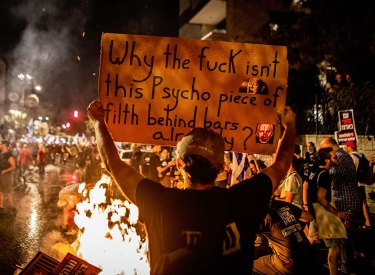Malochen ohne Staat
Vorrei una pizza, per favore. Wer so fragt, weiß meistens nicht, daß er oder sie ein schweres Verbrechen begeht: Beihilfe zur Schwarzarbeit. Aber auch wer Armani-Anzüge oder Gucci-Schuhe kauft, kann so schwere Schuld auf sich laden, daß selbst die Beichte beim papa in Rom das Gewissen schwerlich beruhigt.
Allerdings: Wo viel Sonne, ist auch viel Schatten. Schattenwirtschaft. Schwarzarbeit. Und die gibt es überall. Am meisten aber dort, wo sie am wenigsten vermutet wird: im reichen Norditalien, wie eine jüngst veröffentlichte Studie des italienischen Sozialforschungsinstituts Censis ans Licht gebracht hat. Ob Mode-Industrie oder Maschinenbau - an jeder Fräs- oder Nähmaschine werkeln flinke Arbeiter, die nirgendwo gemeldet sind.
Der Grund für den Fleiß: Ohne die Mühsal des sommerso, der Schwarzarbeit, wären die italienischen Außenhandelszahlen hochdefizitär ausgefallen, die Lira wäre eingebrochen, der Beitritt zur europäischen Währungsunion undenkbar gewesen, ebenso, daß Romano Prodi einen hochdotierten Posten in Brüssel abfaßt.
Das wollen die Sozialforscher von Censis natürlich nicht wahrhaben. Für sie ist Schwarzarbeit so verwerflich wie eine Heimniederlage des AC Milano gegen Borussia Dortmund. Kein Wunder, daß sie den fleißigen signori e signore niedrige Motive unterstellen. Schnöde Geldgier und der vorauseilende Gehorsam gegenüber D'Alemas neokeynesianistischer Wirtschaftspolitik sind für die Censis-Datensammler das Hauptmotiv der agilen Jobber, Freizeit gegen Handys oder Surfmaschinen zu tauschen.
Nur im äußersten Süden der Halbinsel, so Censis, sieht es ein wenig anders aus. Nicht mit der Schwarzarbeit, sondern mit den Motiven: Denn hier werde entweder schwarz oder gar nicht gearbeitet. Eine "Schattenwirtschaft der Not" haben die Forscher aus dem Lega-Ländle im Mezzogiorno ausgemacht. Besonders verwerflich: Illegale Beschäftigung werde hier nicht als etwas Unwürdiges, sondern als Normalität angesehen: auf der Baustelle, im Ristorante oder beim Agri-Tourismo. Steuern berappen? Sozialabgaben leisten? Non si paga. Bezahlt wird nicht. Rom ist weit.
Darüber ist nicht nur Censis sauer. Auch das staatliche Amt für Statistik kommt ins Jammern, wenn mal wieder Zahlen präsentiert werden müssen: Rund ein Viertel des italienischen Bruttosozialprodukts werde "schwarz" erzeugt. Und daran seien nicht allein die Proleten schuld: Nur knapp mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Italien arbeiten "vollständig regulär", fast 30 Prozent "hinterziehen systematisch Steuern und Abgaben", jeder sechste Betrieb ist für die Behörden überhaupt nicht "sichtbar".
Erklärungsversuche neoliberaler Ökonomen, die "Schattenwirtschaft als Geburtshelferin für wirtschaftliche Initiativen" deuten, wollen die nationalen Zahlenschieber nicht teilen. Schattenwirtschaft sei weder dynamisch noch gut für die Konkurrenz, und der Volkswirtschaft bringe sie auch nichts: Lieber rote Zahlen bei Olivetti als schwarz gepflückte Oliven.
Nach den von Censis präsentierten Daten liegt Italien im europäischen Schwarzarbeitsvergleich an erster Stelle. Es folgen Belgien (illegale Pommesfrittierer), Schweden (Gewalt im Wald ohne Steuerkarte) und Norwegen (Schnaps brennen gegen den Staat). Die letzten Plätze nehmen Österreich und die Schweiz ein. Aber da ist ja auch schon genug Schatten.
O sole mio.