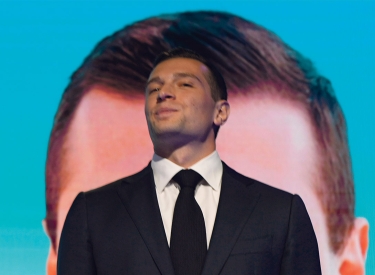Bauernopfer für Europa
Europas Bauern machen mobil. Rund 30 000 wollen am kommenden Montag mit Mistgabeln und Traktoren das Treffen der Landwirtschaftsminister in Brüssel begleiten. Dort sollen die letzten Weichen für die seit anderthalb Jahren diskutierte "Agenda 2000" gestellt werden. Und mit dem, was bislang auf dem EU-Verhandlungstisch liegt, ist ein Großteil der bäuerlichen Welt nicht einverstanden. Von Ost bis West sind sich die Landwirte einig, daß diese Agenda den Bauern in Europa den Rest geben wird.
Dabei soll die Agenda 2000 zukunftsweisend sein für die EU-Politik des nächsten Jahrtausends. Bereits im Juli 1997 legte die Kommission auf der Tagung des Europäischen Rates in Berlin den Entwurf vor, am 24. und 25. März soll nun darüber entschieden werden. Dabei stellt die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bislang den einzigen Bereich dar, der öffentlich stark diskutiert wird. Denn neben der Reform des Agrarpolitik sieht die Agenda noch zwei weitere Aufgaben vor: Sie definiert die geplante Osterweiterung sowie den Finanzrahmen der EU für die Zeit von 2000 bis 2006.
Nachdem bereits nach der ersten Vorstellung die Gemüter kochten, präzisierte die Kommission im März letzten Jahres ihre Vorschläge: Die europäische Landwirtschaft muß fit werden für den Weltmarkt. Die EU will deshalb die bislang garantierten Preise für Rindfleisch, Milch und Getreide um bis zu 30 Prozent senken. Als Ausgleich für die Einbußen sieht die Kommission Direktsubventionen für die betroffenen Betriebe vor. "Diese Maßnahme ist notwendig", erklärte der für den Bereich Landwirtschaft zuständige Kommissar Franz Fischler auf der Grünen Woche in Berlin, "denn aufgrund unserer internationalen Verpflichtungen ist es ab 2003 verboten, die Agrarproduktion zu subventionieren".
Er bezieht sich damit auf den Liberalisierungskurs der internationalen Handelsorganisation (WTO): Diese will im nächsten Jahrtausend keine künstlichen Verbilligungen von Exportgütern mehr sehen. "Ohne Reform werden wir schnell vor neuen Fleisch- und Getreidebergen, unsinnigen Ausgaben und drastischen Produktionsauflagen stehen", sagte Fischler weiter.
Die Agenda sieht nun vor, daß Ausgleichszahlungen an Umweltauflagen gebunden werden können. Zusätzlich soll die Summe pro Betrieb nach oben hin begrenzt werden. Gerade diese beiden Punkte waren es, die vor allem den Ex-Landwirtschaftsminister Wolfgang Borchert auf die Palme brachten. "Wachstumsbetriebe" würden benachteiligt, wetterte er und sah gleichzeitig "Milliardenverluste" auf die Landwirtschaft zukommen.
Borchert kündigte ein deutsches Veto in Sachen Agenda 2000 an. Auch der von Brüssel vorgelegte Finanzplan stieß auf Widerstand. Beim Geld höre die Freundschaft auf, erklärte auch der frisch-gewählte Bundeskanzler Gerhard Schröder Mitte Dezember vor dem Regierungsrat in Wien. Weil Deutschland wegen seines hohen Bruttoinlandsprodukts derzeit rund 28,2 Prozent des europäischen Haushalts bestreitet, jedoch nur 12,8 Prozent zurückfließen, würde man hierzulande die Art und Weise, wie die Beitragssummen berechnet werden, gerne geändert sehen.
Wie stark der Einfluß der deutschen Lobby in Brüssel ist, konnte der ehemalige Landwirtschaftsminister Wolfgang Borchert (CDU) noch während seiner Amtszeit unter Beweis stellen: Er sicherte das Beibehalten der sogenannten Silomaisprämie - das sind rund 500 Millionen DM, von denen die Hälfte nach Deutschland fließt. Die Kommission wollte die Prämie abschaffen. Daß der neue Verhandlungstext die Prämie jetzt wieder vorsieht, zeigt zugleich auch die schizophrene Seite der Agenda. Denn gerade die Unterstützung des Maisanbaus fördert die intensive Landwirtschaft: Bauern, die, statt Mais zu verfüttern, ihre Bullen und Kühe auf die Weide schicken, bekommen keine Prämien.
Unter der deutschen EU-Präsidentschaft leitet der neue Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke (SPD) nun die Verhandlungen. Der hat nach dem Vorbereitungstreffen des EU-Agrarrats Mitte Januar eine "deutliche Verengung der Diskussion" festgestellt - die südlichen Mitgliedsstaaten wie Spanien und Portugal, aber auch Frankreich und Dänemark lehnen die deutschen Vorschläge bisher vehement ab. Im Europarlament wurden bereits über 500 Änderungsanträge zu den von der Kommission vorgeschlagenen Agrarreformplänen eingereicht.
Der harsche Widerspruch ist nicht verwunderlich; immerhin geht es im Agrarbereich um rund 80 Milliarden DM - die Hälfte des gesamten EU-Haushalts ist an die GAP gebunden. Und es geht um Arbeitsplätze, ganz besonders in Osteuropa. In den 15 EU-Mitgliedsstaaten arbeiten derzeit noch rund acht Millionen Menschen im Agrarsektor - 1958 waren es 16 Millionen, die allein in den sechs Gründerstaaten der EWG in der Landwirtschaft tätig waren.
Die ständige Subventionen aus Brüssel stößt derweil beim nicht-bäuerlichen Teil der europäischen Bevölkerung immer weniger auf Verständnis. "Die Reformvorschläge verfolgen das Ziel, die Landwirtschaft mit den EU-Bürgern zu versöhnen", sagt deshalb EU-Kommissar Franz Fischler, "denn die Bauern werden dazu verpflichtet, konkrete Umwelt- und Tierschutzstandards einzuhalten." Ein Grund, wieso die Agenda an anderer Stelle Zustimmung findet: Umweltverbände und Biobauern begrüßen einige der vorgeschlagenen Maßnahmen.
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), nennt die Agenda "ein Schritt in die richtige Richtung". Er beklagt vor allem, daß bislang 40 Prozent der Brüsseler Prämien an die vier Prozent der Betriebe mit den größten Flächen gehen - ausgerechnet an die Höfe also, die es am wenigsten nötig haben. Deshalb will der EU-Abgeordnete künftig die Unterstützungen daran bemessen, wieviel Arbeitskräfte in einem landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt sind. Je mehr Menschen auf einem Hof arbeiten, desto höher die ausgezahlten Subventionen.
Noch ist sein Vorschlag nicht gestrichen, allerdings könnte es damit wie mit anderen "fortschrittlicheren" Teilen der Agenda gehen: Ökologische oder soziale Auflagen kommen nur als Kann-Bestimmungen im Text vor. Es bleibt demnach den einzelnen Nationen überlassen, ob sie diese Bestimmungen übernehmen oder nicht. Denn der Tenor bleibt unumstritten: Orientierung auf den Weltmarkt und die ist für EU-Bauern gefährlich. Denn was für sie besser werden soll, wenn nicht mehr Brüssel bestimmt, was auf den Feldern wächst, sondern statt dessen der Weltmarkt die Fruchtfolge diktiert, konnte bislang kein EU-Vertreter plausibel erklären.