Jacob der Lügner
Es gibt Menschen, deren geistige Physiognomie erst dann Konturen gewinnt, wenn sie mit der ihrer Gegenspieler konfrontiert wird. Die sind fast nie einfach nur Konkurrenten, Neider oder Feinde. Vielmehr stacheln sich Gegenspieler, die diesen Namen verdienen, im Kampf gegeneinander dazu an, ihr eigenes Talent auszubilden. In diesem Sinne bewies Jacob Taubes bei der Wahl seiner Gegenspieler größere Begabung als bei der Wahl seiner Freunde. Letztere haben ihm immer wieder zum Nachteil gereicht. Aus einer Wiener rabbinischen Gelehrtenfamilie stammend, die 1936 in Vorahnung drohender politischer Verfolgung nach Zürich emigriert war – sein Vater war dort zum Oberrabbiner der Israelitischen Cultusgemeinde ernannt worden und hatte die Berufung genutzt, um Österreich zu verlassen –, studierte Jacob Taubes ab 1941 in Zürich, Basel und Montreux Griechisch, Latein, Alte Geschichte und Philosophie. Zugleich absolvierte er, der Familientradition folgend, eine Rabbinerausbildung, die er 1943 abschloss. Er hörte Vorlesungen bei dem Germanisten Emil Staiger, dem Soziologen René König und promovierte 1947 mit der erst wesentlich später bekannt gewordenen Studie »Abendländische Eschatologie«, der einzigen Monographie, die er je veröffentlicht hat. Zur gleichen Zeit freundete er sich mit Armin Mohler an, der später Privatsekretär von Ernst Jünger wurde, und entwickelte eine Faszination für das Werk von Carl Schmitt, die sein Leben lang andauerte.
Die Sprache, die Taubes sprach, entstammte den zwanziger Jahren, als sich im »gefährlichen Denken« eines Ernst Niekisch, Ernst Jünger und Carl Schmitt linke wie rechte Affekte gegen Demokratie und Liberalismus verbanden.
Die Schweiz war für solche politischen Grenzgänge prädestiniert, denn hierher waren schon während des Ersten Weltkriegs nicht nur bürgerliche Juden, Linkssozialisten und Exponenten der west- und osteuropäischen Kunstavantgarden emigriert – Zürich wurde dadurch zum Zentrum des Dadaismus –, sondern auch Katholiken und Vertreter der sogenannten Konservativen Revolution. Obwohl die vielberufene Schweizer Neutralität Platz für fast jeden Obskurantismus bot, war es auch hier eher ungewöhnlich, dass der sich selbst als »linksextrem« einstufende Sohn einer Rabbinerfamilie geradezu obsessiv Vertraulichkeit mit Leuten suchte, die einer politischen Bewegung nahestanden, die Menschen wie ihn systematisch auslöschen wollte. Warum Taubes Freundschaften mit Denkern einging, die er als seine politischen Feinde einstufen musste, während er umgekehrt Freunde, die ihm lebensgeschichtlich und geistig näher standen – wie Gershom Scholem und Hannah Arendt – immer wieder vor den Kopf stieß, auf diese Frage gibt die »Abendländische Eschatologie« eine Antwort. Die Intention dieses Buchs, das eher ein politisch-theologisches Pamphlet als eine religionswissenschaftliche Studie ist, besteht in dem Versuch der Wiedererweckung der revolutionären Geschichtsphilosophie aus dem Geist der Apokalyptik. »Zeit heißt Frist«, schreibt Taubes in seinem durchweg antiakademischen Stil: »Wer christlich zu denken glaubt und dies ohne Frist zu denken glaubt, ist schwachsinnig.«
Wenn es eine Geschichte gibt, die von der Geschichtsphilosophie auf den Begriff zu bringen wäre, so muss es Taubes zufolge eine Teleologie, eine auf Finalität, Zerstörung und Erneuerung hin ausgerichtete immanente Logik allen menschlichen Handelns und Denkens geben. Deren theologisches Sediment erkennt er in der Apokalyptik: »Apokalypse ist, dem Wort und dem Sinn nach, Enthüllung. (…) In den ersten Zeichen wird schon das Vollendete erblickt und kühn das Erschaute ins Wort gestellt, um das noch nicht Erfüllte voraus zu winken. Der Sieg der Ewigkeit vollzieht sich auf dem Schauplatz der Geschichte.« Ende der vierziger Jahre, als Taubes’ Dissertation entstand, wirkten solche Gedanken, die Theologie und Geschichtsphilosophie, sakrale und profane Zeit, heroisch und mit teilweise unfreiwillig komischem Sprachpathos zu verbinden suchten, wie aus der Zeit gefallen. Die späten vierziger, frühen fünfziger Jahre waren in den westlichen Staaten eine Epoche philosophischer wie theologischer Nüchternheit, in der dem Naheliegenden, aber Machbaren vor dem Utopischen der Vorzug gegeben wurde. Die Sprache, die Taubes sprach, entstammte dagegen den zwanziger Jahren, als sich im »gefährlichen Denken« eines Ernst Niekisch, Ernst Jünger und Carl Schmitt linke wie rechte Affekte gegen Demokratie und Liberalismus verbanden. Dass zwischen der Weimarer Republik und jener Gegenwart der Nationalsozialismus lag, der den geistigen Extremismus der Zwanziger vollends korrumpiert hat, war Taubes bewusst. Dass er es wusste und trotzdem zu denken versuchte, als wüsste er es nicht, charakterisiert sein Werk.
Zu sich selbst kam dieser Impuls von Taubes‘ Werk erst spät: Nicht ab 1949, als er in New York Religionsphilosophie lehrte und Schüler und Gesprächspartner von Leo Strauss wurde, der ihm im Interesse an der Verbindung von Politik und Theologie nahe war, dessen lebenszugewandter Pragmatismus ihm jedoch fremd blieb; und auch nicht zwischen 1951 und 1953, als er auf Einladung von Gershom Scholem als Dozent an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrte. Vielmehr endete diese Zeit mit einem Zerwürfnis, das ein langes Nachspiel hatte. Dass Scholem Taubes bald für intransigent und gefährlich hielt, lag daran, dass er in der »Abendländischen Eschatologie« die Wiederkehr protofaschistischer Tendenzen aus der Zeit von Weimar witterte. Taubes seinerseits hat von seiner passiv-aggressiven Bewunderung für Scholem Jahrzehnte nicht ablassen können und entwarf noch 1977 den Plan, eine »Anti-Festschrift« für ihn herauszugeben, die eine Reihe von als Würdigungen begriffenen Polemiken enthalten sollte. Hans Blumenberg hat ihm das schließlich ausgeredet.
Wahrhaft zur Geltung kam das von Taubes gepflegte »gefährliche Denken« erst seit 1966, als er Ordinarius für Judaistik und Hermeneutik an der Freien Universität Berlin wurde. In dieser Vor-Zeit der Achtundsechziger-Bewegung schien, wofür Taubes sich immer interessiert hat, auf der Tagesordnung zu stehen: Geschichte als Einbruch des ganz Anderen in die Wiederkehr des Immergleichen. In jener Zeit hatte Taubes zwei neue Gegenspieler, die ihm gerecht wurden, indem sie ihm widersprachen: Peter Szondi, Ordinarius am Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und ebenfalls ein Schüler Emil Staigers, sowie Klaus Heinrich, der an der FU die Professur für Religionswissenschaft innehatte.
Szondi war Taubes ähnlich darin, dass er nur wenig publiziert hatte (im Grunde nur die 1956 erschienene »Theorie des modernen Dramas«) und als chronisch schwieriger Charakter galt. Unähnlich war er ihm in seiner freundlichen Abneigung gegen die Studentenbewegung und in dem Bemühen, hermeneutische Akribie im Umgang mit Texten walten zu lassen, statt sie für politische Programme in Dienst zu nehmen. Heinrich war Taubes in seinen gesellschaftspolitischen Vorstellungen näher, bestritt jedoch – darin wiederum Scholem ähnelnd –, dass Religionsgeschichte je wieder Theologie werden, dass historisches Wissen und die Sehnsucht nach Transzendenz sich versöhnen könnten. Zwischen Taubes, Heinrich und Szondi bildete sich seit den Sechzigern bis hinein in die achtziger Jahre ein intellektuelles Milieu heraus, dessen Lebendigkeit das Studium an der FU unvergleichlich originell machte. Hierhin gehörten Literaturwissenschaftler (Klaus Laermann, Marlies Janz, Sylvelie Adamzik), Soziologen (Dietmar Kamper, Gerburg Treusch-Dieter), Religionswissenschaftler (Renate Schlesier) und Medienwissenschaftler (Norbert Bolz).
Dieses Milieu war experimentierfreudig und phantasievoll, man konnte dort über die verborgene Radiotheorie von Franz Kafka, über Sexualfetischismus bei Adalbert Stifter und über das literarische Partisanentum Heinrich von Kleists forschen. Die Kehrseite solchen Forschungsglücks war eine Beliebigkeit, die seit Mitte der achtziger Jahre in der Mode des Poststrukturalismus mündete und die Unterschiede zwischen Forschung und Hochstapelei immer mehr verwischt hat. Schon Taubes selbst war von Freunden »Jacob der Lügner« genannt worden, weil er je nach Bedarf eigene Werke erfinden konnte, die er nie zu schreiben vorhatte. Was bei Taubes Ausdruck von Charme und Geist gewesen ist und an ihm zu Recht bewundert wurde, ist im heutigen Universitätsbetrieb zum schlechten Alltag geworden: Wo sich jeder Akademiker für den nächsten Drittmittelantrag Gründe für die Finanzierung unausgearbeiteter Ideen aus den Fingern saugen muss, ist die Phantasie, die Taubes teuer war, zum Mittel der Subsistenzsicherung verkommen.





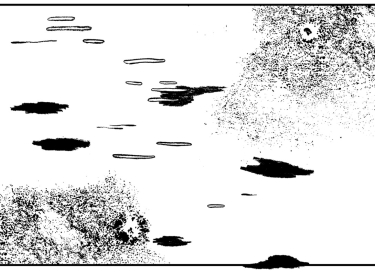
 »Birkenschwester«: Rückwärts zurück
»Birkenschwester«: Rückwärts zurück