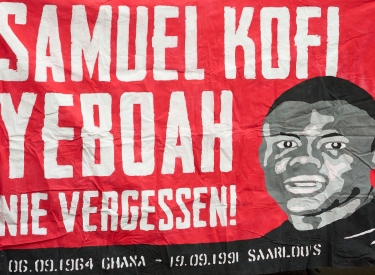Ferienintifada auf der Fusion
Das Musikfestival Fusion ist bekannt als eine riesige Party. Es hat aber immer auch einen politischen Anspruch gehabt. Am 26. Juni soll das Festival beginnen, es häufen sich die Konflikte: Es geht – wie könnte es anders sein – um Antisemitismus.
Was Israel angeht, hatte die Fusion stets versucht, verschiedenen Positionen Raum zu geben. In früheren Jahren konnten problemlos Gruppen wie »Palästina spricht« am Festival mitwirken und dort politische Inhalte verbreiten – eine Gruppe, die mittlerweile den 7. Oktober 2023 als »revolutionären Tag« gefeiert hat, auf den man »stolz sein« könne.
Dass es so nach dem Pogrom der Hamas, zu dessen Zielen unter anderem Besucher eines israelischen Musikfestivals zählten, nicht einfach wie gehabt weitergehen konnte, schien man zunächst auch bei der Fusion verstanden zu haben. Im Februar veröffentlichte Kulturkosmos – der Verein, der das Festival veranstaltet – deshalb einen Newsletter, um sich »zu positionieren«. Darin formulierte der Verein eine scharfe Kritik an Israels Kriegführung: »Der ›Krieg gegen die Hamas‹« sei »längst zu einem Krieg gegen die palästinensische Zivilbevölkerung geworden«, die israelische Gesellschaft befinde sich in einem »nie dagewesenen nationalistischen Taumel«. Er schrieb jedoch auch, dass, wer die Hamas feiere und das Existenzrecht Israels bestreite, auf dem Festival nicht willkommen sei.
Der Krieg in Gaza sei »Völkermord« und die israelische Besatzung »Apartheid«, schrieb die Festivalleitung – man habe diese Begriffe zuvor lediglich aus »falscher Rücksicht auf deutsche Befindlichkeiten« vermieden.
Das provozierte den Zorn der antiisraelischen Szene. Im Mai veröffentlichte »Palästina spricht« einen offenen Brief. Der »Versuch des Fusion-Festivals, akzeptable Formen des Protests und Widerstands zu diktieren«, sei »Zensur«, hieß es dort. Dass die Fusion »die Existenz eines Apartheid-Ethnostaates« anerkenne, »zeigt eine blinde Ausrichtung am zionistischen Projekt«. Deshalb hätten »wir, Künstler:innen aus Palästina, dem Globalen Süden und unsere Verbündeten«, entschieden, das Festival zu boykottieren, andere seien aufgerufen, sich ihnen anzuschließen.
Noch am selben Tag veröffentlichte die Festivalleitung einen neuen Newsletter. Darin schrieb sie zunächst, es handele sich nicht um eine Antwort auf die Boykottkampagne von »Palästina spricht«. Das erscheint allerdings unglaubwürdig. Denn die Festivalleitung revidierte in ihrem Text betont reuevoll, was sie im Newsletter vom Februar geschrieben hatte. Dass man sich im vorherigen Newsletter zu einem nicht verhandelbaren Existenzrecht Israels bekannt hatte, nannte die Festivalleitung nun »undifferenziert und plakativ«. Der Krieg in Gaza sei »Völkermord« und die israelische Besatzung »Apartheid« – man habe diese Begriffe zuvor lediglich aus »falscher Rücksicht auf deutsche Befindlichkeiten« vermieden.
»About Blank« und »Bajszel« mit roten Dreiecken besprüht
Auf diese Art geht es weiter: »Gerade jetzt, in einer Zeit, da viele kulturelle Institutionen in Deutschland angesichts der staatlichen Repression gegen israelkritische Positionen unter Antisemitismusverdacht gestellt werden«, sei es »umso wichtiger, auch weiterhin palästinensischen Stimmen Raum auf der Fusion zu geben«. Man »fühle« sich bei der Fusion »grundsätzlich solidarisch mit denen, die in der Welt ihren Protest gegen den Krieg in Gaza und ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk auf die Straße bringen und dies auch auf der Fusion zum Ausdruck bringen wollen, selbst wenn wir nicht immer dieselben Positionen haben«.
Darüber, dass dieser Protest weder verhehlen kann noch verhehlen will, antisemitischen Motiven zu folgen: kein Wort. Offenbar will man nichts davon wissen, dass etliche Leute aus dem Kultur- und Subkulturbetrieb sich nicht mehr lediglich mit Palästinensern solidarisieren, sondern Antisemitismus in seinen vielfältigsten Erscheinungsformen Club- und HU-Tor öffnen, und damit ein Klima schafften, in dem in Berlin unter anderem der Club »About Blank« und die Kneipe »Bajszel« mit den roten Dreiecken besprüht wurden, mit denen die Hamas ihre Feinde markiert, und jüdische Studierende sich zum Teil nicht mehr an die Universität trauen. Stattdessen heißt es, dass man noch stärker einen »möglichst diskriminierungskritischen Raum schaffen« schaffen wolle. Es zeigte sich mal wieder – wenn es um Diskriminierung geht, gilt für viele Linke: Juden zählen nicht.
Während man Hamas-Fans die Hand reicht, ignoriert man die Kritik von Juden und Jüdinnen und denen, die sich mit ihnen und Israel solidarisch zeigen.
An der Fusion wirken zahlreiche Menschen mit, viele von ihnen unbezahlt. Inzwischen regt sich deutlicher Widerspruch gegen die Festivalleitung. Am 7. Juni veröffentlichten »Crews, Crewmitglieder, Artists und Mitglieder bundesweiter Strukturen, die die Fusion (auch) in diesem Jahr mitgestalten woll(t)en«, eine Stellungnahme unter dem Namen »Fusionistas against Antisemitism and Antizionism«.
Man sei fassungslos, hieß es dort an die Festivalleitung gerichtet, »dass ihr kurz vor dem Festival, wenn kaum noch eine Reaktion unsererseits möglich ist, ein Statement veröffentlicht habt, das dem gerade noch konsensfähigen Statement vom Februar (auch dieses stieß vielen inhaltlich auf und wurde als problematisch empfunden) widerspricht bzw. die dort formulierten ›roten Linien‹ aushebelt«. Die Fusion reagierte darauf mit einer neuen Stellungnahme, in der sie aber nichts zurücknahm, sondern sich lediglich dafür entschuldigte, »kurz vor Festivalbeginn Unruhe verursacht« zu haben.
Mit viel Wohlwollen kann man das Vorgehen der Fusion, gerade mit Blick auf die Tradition des Festivals, ein wenig nachvollziehen. Die Fusion – das sind vier Tage Utopie, Ferienkommunismus, Hedonismus: Irgendwo zwischen Turmbühne und Bachstelzen sollen sich alle liebhaben. Mitgefühl und Solidarität mit Menschen im Gaza-Streifen (unter denen sich bekanntlich ja auch noch israelische Hamas-Geiseln befinden) soll dort also ebenso Platz haben wie die Kritik am Antisemitismus.
Dass die Fusion aber tatsächlich das vermutlich kaum mehr Mögliche wagt, beidem Raum zu geben, ist aber nicht einmal mehr in Ansätzen zu erkennen. Während man Hamas-Fans die Hand reicht, ignoriert man die Kritik von Juden und Jüdinnen und denen, die sich mit ihnen und Israel solidarisch zeigen.


 Unterm Techno liegt der Antisemitismus
Unterm Techno liegt der Antisemitismus