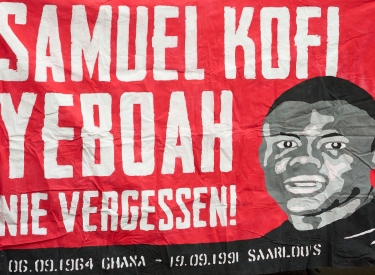Deutsche Tradition
Es war der zweite Angriff innerhalb weniger Wochen. Bereits Mitte Mai wurde ein Ziegelstein auf eine Einrichtung der Lebenshilfe Mönchengladbach geworfen. Vergangene Woche traf es dann ein Wohnheim der Lebenshilfe für behinderte Menschen – und diesmal trug der Ziegelstein eine Aufschrift: »Euthanasie ist die Lösung«. Die Ermittlungsbehörden gehen daher von einem rechtsextremen Hintergrund der Taten aus. Als »Euthanasie« (altgriechisch; bedeutet in etwa »einen guten Tod bringen«) bezeichneten die Nationalsozialisten euphemistisch den systematischen Mord an Hunderttausenden Behinderten.
Die Verachtung von Behinderten und der Begriff des »lebensunwerten Lebens« sind zentrale Bestandteile nationalsozialistischer Ideologie. Das gilt auch für den heutigen Rechtsextremismus. Es überrascht kaum, dass sich in den internen Chatverläufen der NPD-Jugend, über die vergangene Woche der Spiegel berichtete, Sprüche fanden wie »Jetzt oder nie … Euthanasie«.
1920 führte ein Heim eine Umfrage unter den Eltern der Heimpatienten durch, ob sie »in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen« würden. 73 Prozent antworteten mit »ja«.
In der öffentlichen Wahrnehmung spielt die Behindertenfeindlichkeit allerdings im Vergleich zu Rassismus oder Antisemitismus eine eher untergeordnete Rolle. Doch gerade in diesem Bereich reicht rechtsextremes Denken bis weit in die gesellschaftliche Mitte. Bereits der Begriff des »lebensunwerten Lebens« ist keine nationalsozialistische Erfindung, sondern stammt aus dem 1920 erschienenen Buch »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens – Ihr Maß und ihre Form« der beiden Professoren Karl Binding (bis 2010 Ehrenbürger der Stadt Leipzig, bis heute Ehrendoktor der Universität Leipzig) und Alfred Hoche (bis heute Ehrendoktor der Universitäten Freiburg und Tübingen). Das Buch hat den Hoche-Schüler und späteren SS-Arzt und Leiter der nationalsozialistischen Behindertenvernichtung, Werner Heyde, nachhaltig geprägt.
Luther wollte behinderte Kinder im Fluss ertränken
Eine Mehrheit der Deutschen konnte mit den Plänen der Nationalsozialisten gut leben. Ewald Meltzer, Leiter eines Heims, von dessen 250 Bewohnern nur 25 die Massenmorde der Nazis überlebten, führte 1920 eine Umfrage unter den Eltern seiner behinderten Heimpatienten durch, ob sie »in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen« würden. 73 Prozent bejahten das. Die Frage, »Wenn ein schwer behindertes Kind geboren wird, wäre es da nicht für alle besser, wenn man dieses Kind sterben lassen würde?«, beantworteten in einer Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2000 immerhin noch rund 60 Prozent der befragten Deutschen mit »ja«.
Die Verachtung von Behinderten ist gute Tradition in Deutschland. Der protestantische Reformator Martin Luther empfahl in seiner Tischrede mit der Nummer 5.207, behinderte Kinder im Fluss zu ertränken, da sie »seelenlose(r) Fleischklumpen« seien.
Höcke sprach sich gegen Inklusion behinderter Kinder aus
Beim Hass auf Behinderte scheint es in Deutschland regionale Unterschiede zu geben. Die Leipziger Autoritarismus-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt in der Dimension »Sozialdarwinismus (Neo-NS-Ideologie)« latente Zustimmungswerte von 31 Prozent in Ostdeutschland und von 12,7 Prozent in Westdeutschland zu der Aussage »Es gibt wertvolles und unwertes Leben«. 31 Prozent und 12,7 Prozent – das könnten auch AfD-Landtagswahlergebnisse aus Thüringen und Rheinland-Pfalz sein. Man sollte aber nicht denken, dass das lediglich ein AfD-Thema sei. Als sich Björn Höcke zum Beispiel im vergangenen Jahr gegen Inklusion behinderter Kinder an Schulen aussprach (das bringe »unsere Kinder nicht weiter«), erhielt er Zuspruch weit über das übliche Parteimilieu hinaus.
Mit solchen Einstellungen mag zusammenhängen, dass die Behindertenvernichtung in Deutschland selbst durch die maßgebliche Gedenkstätte in Hadamar und das Mahnmal in Berlin an der Tiergartenstraße 4 ganz selbstverständlich als »Euthanasie« bezeichnet wird – immerhin in Anführungszeichen.
Die Stadt Mönchengladbach zeigte sich solidarisch mit den in ihrem Wohnheim angegriffenen Behinderten, denen die unbekannten Täter mit ihrer Parole auf dem Ziegelstein einen guten Tod nach deutscher Art wünschten.
Aber die Opfer starben keinen »guten Tod« – unter anderem erstickten sie qualvoll in Gaskammern. Sie wurden ermordet von denselben Leuten, die wenige Jahre später ihr Mordhandwerk auch in Treblinka, Sobibor oder Belzec verrichteten. Die personelle und organisatorische Kontinuität zur Shoah war deutlich.
Kein Mensch käme auf die absonderliche Idee, die Shoah heutzutage offiziell als »Endlösung der Judenfrage« zu bezeichnen, Mord als »Sonderbehandlung« oder den Zweiten Weltkrieg als »den uns vom internationalen Judentum aufgezwungenen Krieg« – ob mit Anführungszeichen oder ohne. Aber wenn es um Behinderte geht, tun die Deutschen sich noch heute schwer damit, sich von der euphemistischen NS-Terminologie zu lösen.
Die Stadt Mönchengladbach zeigte sich solidarisch mit den in ihrem Wohnheim angegriffenen Behinderten, denen die unbekannten Täter mit ihrer Parole auf dem Ziegelstein einen guten Tod nach deutscher Art wünschten. Die Öffentlichkeit zeigte sich empört. Das ist gut. Doch vielleicht hatten die Täter auch nur Pech. Wenn die Sätze »Die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht« auf den Ziegelstein gepasst hätten, hätten sie vielleicht statt einer Strafanzeige den »Ethik-Preis« der deutschen Giordano-Bruno-Stiftung erhalten – wie der Philosoph Peter Singer, von dem dieser Satz stammt.







 Mit gelöster Bremse
Mit gelöster Bremse