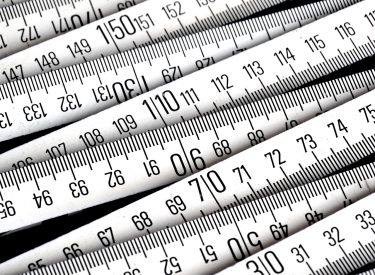Argumentieren statt anfeinden
In der Scholastik war die offene Diskussion widerstreitender Argumente Ausgangspunkt wissenschaftlichen Denkens. Oft wurden solche Disputationen, bei denen These und Gegenthese vorgetragen und begründet beziehungsweise widerlegt wurden, öffentlich abgehalten. Der Theologe und Philosoph Abaelard hatte in seiner Schrift »Sic et Non« (»Ja und Nein«, wohl um 1120 veröffentlicht) eine kritische Hermeneutik entwickelt, die dieser Methode zugrunde lag: »Indem wir nämlich zweifeln, gelangen wir zur Untersuchung, und durch diese erfassen wir die Wahrheit.« Abaelard sieht die Diskutanten in der Pflicht, sich mit der Position und den Argumenten des Gegners auseinanderzusetzen.
Das ist inzwischen selten geworden – nicht nur in den sogenannten sozialen Medien, auch in der Wissenschaft. Die viel debattierte Ausgrenzung missliebiger Forscher und Forscherinnen – missliebig deshalb, weil eine ebenso lautstarke wie beharrliche Minderheit sie auf dem Kieker hat – bedeutet das Ende der Diskussion. Diese Minderheit will nicht diskutieren. Sie ist erst zufrieden, wenn die betreffenden Forscher nicht mehr zu Wort kommen. Sie sollen keine Bühne mehr erhalten – wie sollte das etwas anderes als intolerant sein?
Am wichtigsten ist, dass noch eine Verständigung zwischen den Vertretern gegensätzlicher Auffassungen stattfinden kann.
Warum sollte nicht jede und jeder die eigene wissenschaftliche Position im akademischen Rahmen vertreten dürfen? Es ist ja niemand gezwungen, sich diese anzuhören. Natürlich haben Kritiker das gute Recht, ärgerlichen Positionen scharf zu widersprechen, aber warum sollten sie Forscher mundtot machen dürfen? Bei Faschisten kann und sollte man darüber reden, sie von Debatten auszuschließen: keine Bühne für Björn Höcke (AfD), wohl aber für Forscher und Forscherinnen, die jenseits der wissenschaftlichen Institutionen nicht demagogisch in Erscheinung treten.
Meinungsunterschiede und Widersprüche auszuhalten, sie aufzunehmen sowie neuen Konzepten und Lösungen zuzuführen, ist aus der Mode geraten. Dabei hatte ein Großteil der Wissenschaftstheorie im 20. Jahrhundert zu begründen versucht, dass Wissenschaft auf einem offenen Austausch von Argumenten beruht, in dem nichts von Kritik ausgenommen ist.
Das gilt auch für grundlegende, politisch aufgeladene Fragen der Sozialwissenschaft und Philosophie. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der sogenannte Positivismusstreit, der in den sechziger Jahren zwischen dem von Karl Popper und Hans Albert vertretenen Kritischen Rationalismus auf der einen Seite und der von Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas vertretenen Kritischen Theorie auf der anderen ausgetragen wurde. Die Debatte war nicht frei von Bitterkeit und konnte den Dissens darüber, was eigentlich unter Kritik zu verstehen sei, nicht ausräumen, doch sie wurde als intensive argumentative Auseinandersetzung geführt. Heutzutage wäre eine solche Vorgehensweise denjenigen angeraten, die Forscher und Forscherinnen wegen missliebiger Äußerungen persönlich anfeinden, statt sie mit Argumenten zu kritisieren.
Rund 600 teils eher konservative Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich vor einigen Monaten im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammengeschlossen, um gegen die Gefährdung der Freiheit von Lehre und Forschung durch weltanschauliche Normierung und Instrumentalisierung zu protestieren. Da ist nachvollziehbar. Auffällig ist, dass unter den Mitgliedern nahezu niemand mit einem Namen ist, der nicht typisch deutsch klänge.
In Reaktion auf dieses Netzwerk wurde ein zweites, gleichnamiges Netzwerk gegründet. Dieses versteht Wissenschaftsfreiheit »als einen Prozess der Erweiterung von Teilhabe an Wissenschaft«. Wissenschaftsfreiheit bedeute auch, eine kritische Auseinandersetzung mit dem »System Wissenschaft, dessen Funktionieren auch auf Diskriminierung, Prekarisierung und Ausschluss beruht«, zu ermöglichen.
Die Mitglieder des zweiten Netzwerks bringen also die Wissenschaft selbst in Misskredit. Sie werfen ihr vor, sie sei ein »System«, das mittelbar auf Diskriminierung und Ausschluss beruhe, also erst durch diese ermöglicht werde. Weshalb das so sein soll, bleibt unklar. Dass Prekarisierung eine Grundlage des heutigen Wissenschaftssystems ist, würde wohl kaum jemand bestreiten. Die deutsche Universität ist streng hierarchisch gegliedert in fest angestellte Ordinarien und jede Menge prekärer Nachwuchskräfte, die sich von Vertrag zu Vertrag hangeln.
Das gilt aber zunächst einmal unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, auch wenn diese Eigenschaften sicher noch längst nicht bedeutungslos sind. Aber immerhin sind augenscheinlich zahlreiche Professoren und Professorinnen nichtdeutscher Herkunft Mitglieder des zweiten Netzwerks. Davon, dass das System Wissenschaft darauf beruhe, Menschen wie sie von vornherein auszuschließen, kann also keine Rede sein.
Doch was ist dran an der Kritik, die die Mitglieder des zweiten Netzwerks am Wissenschaftssystem äußern? Natürlich sollte man an einer gerechteren Gesellschaft interessiert sein, in der die »Teilhabe an Wissenschaft« allen offensteht. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat der Debatte über Wissenschaftsfreiheit eine Ausgabe ihrer Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschehen gewidmet, in der unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen. Die Hamburger Medienwissenschaftlerin Jiré Emine Gözen ist eine der Initiatorinnen des zweiten Netzwerks. Sie beginnt ihren Beitrag mit der Feststellung, dass Rechtswissenschaft »eine Geisteswissenschaft« sei, »die stets auch den (sich ändernden) gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Kontext« ihrer Forschung im Blick haben müsse. Gözen bezieht sich auf Michel Foucault, der gezeigt habe, dass Wissen immer historisch spezifisch sei und sich nicht »jenseits von Machtverhältnissen und -interessen entfalten könne«.
In der Wissenschaft und ihren Institutionen, so Gözen, hätten sich Praktiken der Selbst- und Fremdbestimmung entwickelt, die »sich an Traditionen anschließen, die auf kolonialen, rassistischen, sexistischen, ableistischen und klassistischen Zuschreibungen und Ausschlüssen fußen. Eine fundamentale Differenzordnung, die dementsprechend aus dem System Wissenschaft resultiert, sind race, gender und class«. Das zeige ein »kritischer Blick in die Geschichte«.
Tatsächlich sah die Welt früher anders aus als heutzutage. Im Feudalismus lebten wenige Adlige und Kleriker in Saus und Braus, während die meisten Menschen darbten. Frauen galten kaum etwas, Juden wurden diskriminiert. In der Neuzeit kolonisierten Europäer ganze Zivilisationen. Entwertet das sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in dieser Epoche gewonnen wurden? »Fußen« sie tatsächlich auf diesen Ausschlüssen und Zuschreibungen?
Das ist nicht mehr als eine moralisierende Behauptung und zugleich ein Musterbeispiel für geschichtsloses Denken. Kritisch-hermeneutische Analyse würde, statt Traditionen die heutige Perspektive als Bewertungsmaßstab überzustülpen, deren historischen Kontext reflektieren und die eigene Sicht dialektisch darauf beziehen. Würde der moralische Horizont früherer Forscher an den Kriterien des 21. Jahrhunderts gemessen, würde trivialerweise kaum einer von ihnen bestehen. Braucht es deshalb eine tabula rasa, einen völligen Neuanfang? Mit Kant, Hume und Marx würde man sich nicht mehr befassen. Kann man das wollen?
Klärungsbezogen ist dagegen der Beitrag der Gießener Philosophin Elif Özmen, die systematisch formuliert, wie viel Kritik wann und in welcher Form zulässig oder sogar geboten ist und wann ideologische Einflussnahme problematisch wird. Das sind die Fragen, um die es in der Debatte über Wissenschaft eigentlich gehen sollte. Am wichtigsten ist allerdings, dass noch eine Verständigung zwischen den Vertretern und Vertreterinnen gegensätzlicher Auffassungen stattfinden kann und nicht nur weltanschauliche Positionen unversöhnlich gegeneinanderstehen.
Ein gutes Beispiel dafür, wie Verständigung gelingen kann, ist die Entwicklung, die ein Forschungsprojekt der Soziologen Matthias Revers und Richard Traunmüller genommen hat. Voriges Jahr veröffentlichten sie eine Studie, die untersucht, wie Soziologiestudierende der Goethe-Universität Frankfurt es mit der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit halten. Die Studie wurde viel diskutiert, denn sie stellte unter anderem fest, dass ein beträchtlicher Anteil der befragten Studierenden sich in bestimmten Fällen dafür ausspricht, diese Freiheiten einzuschränken. Es wurde auch Kritik am Forschungsdesign laut. Infolgedessen haben Revers und Traunmüller sich mit einem Moderator und vier Kritikern zusammengefunden, um ein neues Forschungsdesign zu erarbeiten. Das erscheint vorbildlich für den Versuch, Widersprüche zu geeigneten Synthesen zu führen.