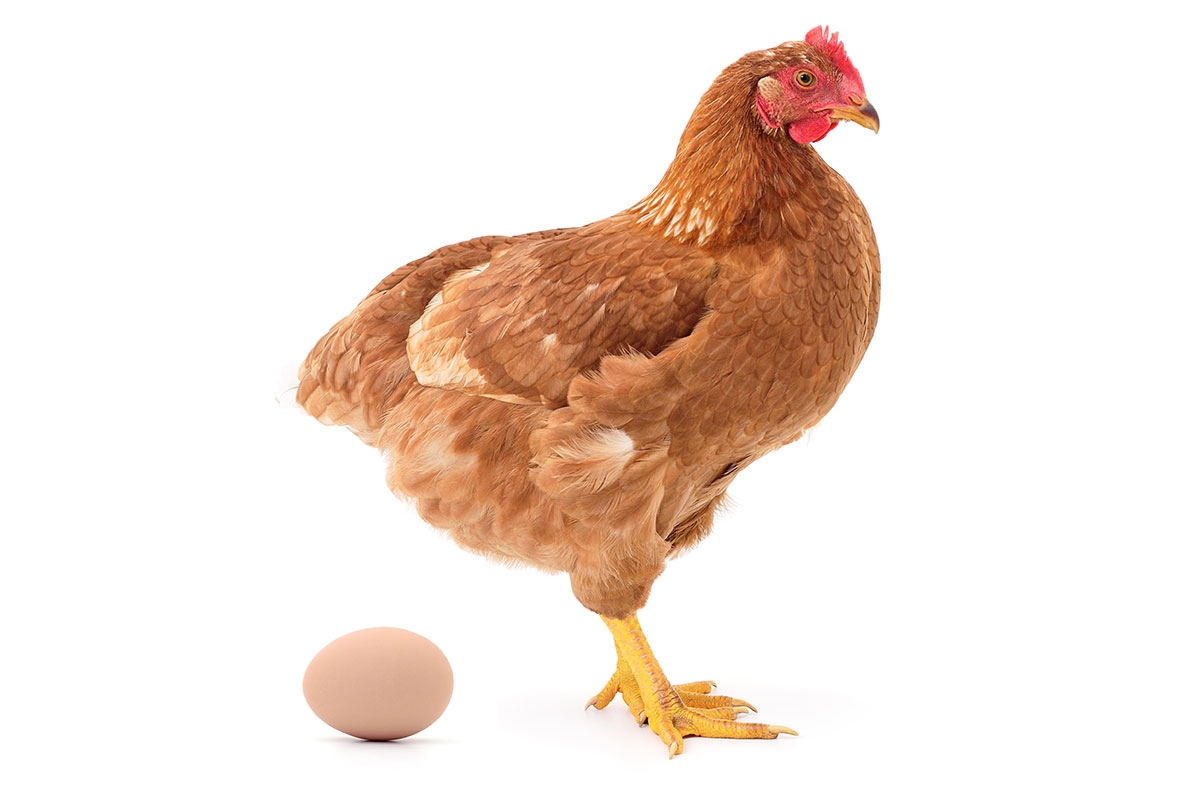Unbegrenzte Bedürfnisse
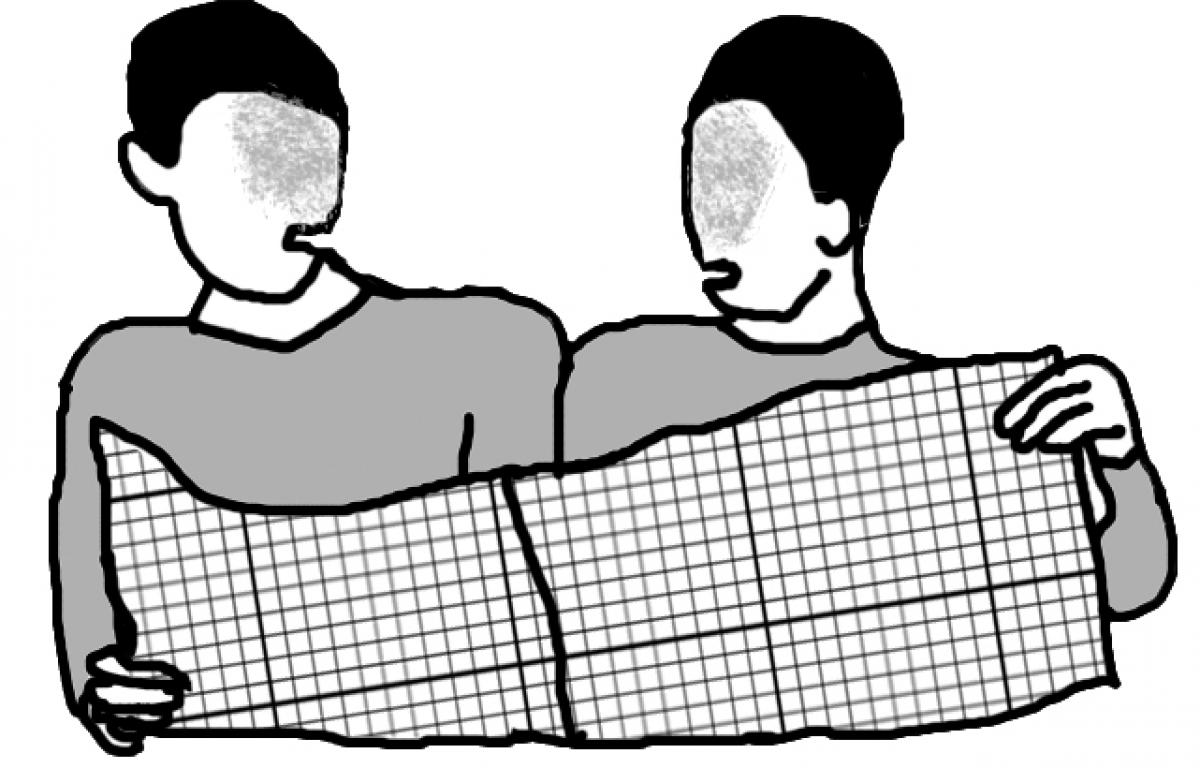 Vor einem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte. Lucas Rudolph argumentierte, dass Bedürfnisse zuvorderst leibliche Regungen sind, die die Verhältnisse spiegeln (23/2024). Christian Schmidt insistierte, dass politische Kämpfe, denen radikale Bedürfnisse zugrunde lägen, bereits stattfänden (25/2024).
Vor einem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte. Lucas Rudolph argumentierte, dass Bedürfnisse zuvorderst leibliche Regungen sind, die die Verhältnisse spiegeln (23/2024). Christian Schmidt insistierte, dass politische Kämpfe, denen radikale Bedürfnisse zugrunde lägen, bereits stattfänden (25/2024).
*
Gesellschaftliche Krisen scheinen zu einer Reflexion über Bedürfnisse anzuregen, deren Befriedigung jene in Frage stellen. Jenseits der grundlegenden Einsicht kritischer Gesellschaftstheorie, Bedürfnisse seien immer schon gesellschaftliche, hat sich die hiesige Debatte über sie einigermaßen verwirrt. Sie entzündet sich an der Möglichkeit der Menschen, subjektiv in die objektiven Kräfte der gesellschaftlichen Vermittlung von Bedürfnissen einzugreifen.
Die Verfasser der »11 Thesen zu Bedürfnissen« fordern eine Politisierung der Bedürfnisse, durch die sie eine transformative und emanzipatorische Gestalt gewinnen und »auf die Überwindung bestehender Herrschafts- und Ausbeutungsformen« zielen sollen. Die an dieser Stelle formulierten Kritiken wenden dagegen ein, allein das Kapitalverhältnis und die in ihm zum Ausdruck kommenden Herrschafts- und Ausbeutungsformen entschieden über die Transformation von Bedürfnissen. Beides – die Determination der durch die herrschenden Verhältnisse und deren Durchbrechung durch emanzipatorische Praxis – sind jedoch Momente derselben geschichtlichen Dialektik, weswegen die Wandelbarkeit von Bedürfnissen sich nicht allein auf eines dieser Momente reduzieren lässt. Marx’ Feststellung, die Menschen machten »ihre eigene Geschichte, aber nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen«, drückt dies aus.
Die Kulturindustrie war die Kommodifizierung eines von Ágnes Heller so bezeichneten radikalen Bedürfnisses nach freier Zeit, deren idealtypisches Publikum die Angestellten waren
Die Frage, ob bestimmten Bedürfnissen selbst ein emanzipatorisches Potential innewohnt, das die Bedürfnisstruktur der gegenwärtigen Gesellschaft zu überschreiten vermag, wie es Ágnes Heller mit dem Begriff der »radikalen Bedürfnisse« behauptet hat, oder ob sich Bedürfnisse erst durch die Abschaffung der kapitalistischen Ökonomie grundlegend zu verändern vermögen, kann Theorie vorweg gar nicht entscheiden. Deshalb tendiert die Debatte prinzipiell zu einer über Henne und Ei, in der beide Positionen gegeneinander recht behalten. Über die geschichtliche Dynamik der Bedürfnisse entscheidet weder ausschließlich das Kapitalverhältnis noch ein subjektiver Faktor in ihm.
Als einen solchen subjektiven Faktor benennen die Verfasser der »11 Thesen« soziale Bewegungen, als deren theoretische Exponenten sie sich selbst begreifen. Aber ihrer Forderung nach einer einigermaßen sozialdemokratisch-liberalen Transformation der Bedürfnisse, einer »freien und gleichberechtigten Teilhabe der Menschen an kollektiven Prozessen der Bedürfnisbildung, -artikulation, -interpretation und -befriedigung«, stehen Schwächen in der Analyse jener Prozesse entgegen. Dass soziale Bewegungen Bedürfnisse artikulieren, ist so richtig wie banal, die prozessuale Logik der Bedürfnisartikulation in den Thesen jedoch analytisch verworren. So werden Bedürfnisse einerseits als immer schon politisch begriffen, wenn etwa von einer Politik der Bedürfnisse, ihren politischen Implikationen oder einer Naturalisierung von Bedürfnissen die Rede ist, die sie entpolitisiere; andererseits soll nun eben jene emanzipatorische Politik der Bedürfnisse gerade darin bestehen, diese überhaupt erst zu politisieren.
Bedürfnis vs. Interessen
Schlichtweg politisch sind Bedürfnisse keineswegs: Unmittelbar wird ein jedes zunächst individuell erfahren. Was in sozialen Bewegungen als Bedürfnis artikuliert wird, bedarf zuvor wahrscheinlich vielfacher gesellschaftlicher Vermittlungen und Übersetzungen und wird sich darin mutmaßlich auch qualitativ verändern. Fraglich daher, ob das, was in den »11 Thesen« Bedürfnis heißt, zuweilen nicht sinnvoller als politische oder sozioökonomische Interessen zu beschreiben wäre.
Dieser Theorie einer gleichsam voluntaristischen Aushandlung von Bedürfnissen steht die schon von Hegel, Marx und Heller formulierte Erkenntnis entgegen, jede Gesellschaftsform bringe ihr eigenes Bedürfnissystem hervor, das sich unabhängig von den Bedürfnissen der Individuen reproduziere. So viel ist auch richtig an der Kritik, die gegen die »11 Thesen« vorgebracht wurde, aber sie dürfte sich nicht damit bescheiden, allgemein auf der Geschichtlichkeit der Bedürfnisse unterm Kapitalverhältnis zu beharren, sondern hätte die Geschichtlichkeit in ihrer besonderen Ausformung in der Gegenwart zu bestimmen. Die Geschichte der Bedürfnisse im Kapitalismus ist schließlich die ihrer zunehmenden Ausdifferenzierung und Individualisierung, die Geschichte der Kapitalisierung vormals nichtkapitalisierter Bedürfnissphären sowie die der erfolgreichen Integration selbst radikaler, potentiell systemverändernder Bedürfnisse.
Verdeutlichen lässt sich das an den Diskussionen über Bedürfnisse, die am Institut für Sozialforschung 1942 in den USA geführt wurden und die den theoretischen Bezugsrahmen auch der jetzigen Debatte bilden. Die damalige Frage nach der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse durch den Wohlfahrtsstaat lässt sich nicht unabhängig von der Kritik der Bedürfnisse verstehen, wie sie Horkheimer und Adorno in der »Dialektik der Aufklärung« als Dialektik von instrumenteller Vernunft und Triebverzicht formulierten. Die Kulturindustrie ist diejenige gesellschaftliche Sphäre, in der Bedürfnisse schematisiert erzeugt werden, ihre Befriedigung aber beständig aufgeschoben wird.
Paradoxie der Bedürfnisproduktion in der Kulturindustrie
Die Paradoxie der Bedürfnisproduktion in der Kulturindustrie ist nun aber gerade, dass deren Entstehung, grob gesprochen, Resultat politischer Kämpfe der Arbeiterbewegung gewesen ist, die dem Kapital ein gewisses Maß an frei verfügbarer Zeit abgerungen hat: Die Kulturindustrie war die Kommodifizierung eines von Heller bezeichneten radikalen Bedürfnisses nach freier Zeit, deren idealtypisches Publikum die Angestellten waren, denen die schematisierten Produkte der Kulturindustrie individualisierte Bedürfnisbefriedigung versprachen. Unter anderem gegen diese schematisierte Produktion von Bedürfnissen in der Kulturindustrie richteten sich später die Forderungen der Achtundsechziger-Bewegung nach Kreativität, Nonkonformität und Authentizität, die wiederum der »neue Geist des Kapitalismus« (Luc Boltanski/Ève Chiapello) erfolgreich integriert hat.
»Manipulation« und »Repression« waren in die historische Situation der späten sechziger Jahre übernommene Begriffe der kritischen Theorie, um die tendenziell totalitäre gesellschaftliche Verordnung von Bedürfnissen zu denunzieren. Von dem Verdacht, dass diese Begriffe es heutzutage kaum noch ermöglichen, die gesellschaftliche Weise der Bedürfnisproduktion in ihren Widersprüchen adäquat zu fassen, hätte eine Theorie und Kritik der Bedürfnisse auszugehen – und zwar in Form von Ökonomiekritik und Sozialpsychologie, die in der Debatte hier kaum eine Rolle spielte.
Was Erstere anbelangt, so hat Joseph Vogl in seinem 2021 erschienenen Buch »Kapital und Ressentiment« dargelegt, wie die Finanzialisierung und die mit ihr entstehende Plattformökonomie eine Retribalisierung von Gesellschaft sowie eine fragmentierte Öffentlichkeit hervorbringen und wie daraus eine neue Logik der Affektökonomie erwächst. Entsprechend diene den Plattformunternehmen auch die Reklame, also jenes Medium, das in der Kulturindustrie noch die Bedürfnisse der Menschen lenken sollte, gar nicht mehr primär diesem Zweck, sondern dazu, im Konkurrenzkampf mit anderen Unternehmen potentielle Investoren von der eigenen Marktmacht zu überzeugen. Im Übrigen trifft Werbung heutzutage ohnehin auf einen aufgeklärten Kunden und bewussten Konsumenten, der nur allzu gut über deren Mechanismen informiert ist und weiß, dass sie ihn manipulieren will.
Gesellschaft, die sich des Lustprinzips bemächtigt
Das wiederum hängt mittelbar mit den Veränderungen zusammen, die die psychische Disposition der Individuen in der neoliberalen Ära durchläuft. Der in der postfordistischen Arbeitswelt grenzenlose Zwang zur Selbstoptimierung korreliert mit einer Veränderung der Gesellschaft, die das Lustprinzip nicht mehr repressiv bändigt, sondern sich seiner bemächtigt, um es den ökonomischen Anforderungen im Neoliberalismus nutzbar zu machen. Mit dem Verschwinden sowohl realer als auch symbolischer väterlicher Autoritäten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verliert auch das Über-Ich tendenziell seine verbietende Funktion, entsprechend erscheinen Bedürfnisse heute weder von oben manipuliert noch repressiv unterdrückt.
Auch die Theorien des Postödipalen, wie sie insbesondere die slowenische Schule marxistisch-psychoanalytischer Theorie formuliert hat, haben darauf hingewiesen, dass der Anspruch der Achtundsechziger-Bewegung nach freier Bedürfnisbefriedigung, die Marcuse als repressionsfreie Libido bezeichnete, einem Diktat des unbegrenzten Genießens gewichen ist, das als Phantasma die Subjekte in einer Endlosschleife zur Bedürfnisbefriedigung anhält. Ob unter diesen Bedingungen noch so etwas wie radikale Bedürfnisse artikuliert werden können, steht ebenso in Frage wie das emanzipatorische Potential freier und gleichberechtigter Bedürfnisartikulation, weil sie sich von den flachen Hierarchien neoliberaler Unternehmenskultur bis hin zum Online-Dating längst marktförmig verwirklicht hat.