Besser weitermachen
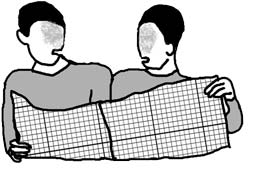 Trotz größerer Mobilisierungserfolge in den vergangenen Jahren wird in der Flüchtlingspolitik der EU alles immer schlimmer – diesen Eindruck könnte man zumindest nach dem Brand in dem griechischen Lager Moria und der Präsentation des EU-Migrationspakts haben. Was tun?
Trotz größerer Mobilisierungserfolge in den vergangenen Jahren wird in der Flüchtlingspolitik der EU alles immer schlimmer – diesen Eindruck könnte man zumindest nach dem Brand in dem griechischen Lager Moria und der Präsentation des EU-Migrationspakts haben. Was tun?
Jahrelang haben sich antirassistische Gruppen, Netzwerke und NGOs abgemüht, um auf das Elend im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam zu machen. Monatelang warnten sie vor einer drohenden Katastrophe durch einen Covid-19-Ausbruch. Unter dem Motto #leavenoonebehind forderten sie die Aufnahme der Menschen aus Griechenland. Viele Medien berichteten ausführlich, wahrscheinlich auch wegen der relativ großen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Beides zusammen zeigte Wirkung: Mitte September sprach sich im ZDF-Politbarometer nur einer von zehn Befragten dagegen aus, Flüchtlinge aus Moria in Deutschland aufzunehmen. In anderen EU-Staaten lag dieser Wert deutlich höher.
Eine Allianz aus antirassistischer Bewegung und Bürgermeistern kann ein Innenminister längst nicht so einfach ignorieren wie die Forderungen von Flüchtlingsgruppen allein.
Für die meisten Flüchtlinge auf Lesbos veränderte sich die Situation nach dem Brand im Lager Moria Anfang September nicht zum Positiven. Sie kamen entweder in ein neues Lager auf einem munitionsverseuchten alten Militärübungsplatz, ohne Duschen und ohne die Möglichkeit, Abstand voneinander zu halten. Etwa ein Drittel der Menschen wurde auf das Festland gebracht, dort aber weitgehend sich selbst überlassen.
Auch auf europäischer Ebene sieht es düster aus. An dem Ende September vorgestellten sogenannten Migrationspakt beeindruckten vor allem die »Abschiebepatenschaften« als neuer Ausdruck »europäischer Solidarität«, wie die EU-Kommission allen Ernstes verkündete. Der sich in diesem Gedanken offenbarende Zynismus zeigt: In der EU hat sich nicht #leavenoonebehind durchgesetzt, sondern die Abschreckungspolitik von Viktor Orbán, Sebastian Kurz und Horst Seehofer. Was soll da noch tun, wer sich mit dem Elend nicht abfinden will?
Vielleicht ist die Antwort unspektakulär: ungefähr so weitermachen. Denn auch, wenn sich in der antirassistischen Bewegung Frust breitmacht, erweisen sich doch viele ihrer Ansätze als sehr richtig.
Das gilt vor allem für die politische Fokussierung auf kommunale Aufnahme, das Bemühen um entsprechende lokale Bündnisse mit Stadtverwaltungen von immer mehr »Seebrücke«-Ortsgruppen oder in Netzwerken wie »Solidarity Cities«. Ein bundesweites Aufnahmeprogramm haben diese Kampagnen unter dem Motto #wirhabenplatz zwar noch nicht bewirkt. Aber das muss nicht so bleiben: Eine Allianz aus antirassistischer Bewegung und Bürgermeistern kann ein Innenminister längst nicht so einfach ignorieren wie die Forderungen von Flüchtlingsgruppen allein.
Weiterzumachen gilt es sicher auch bei der kontinuierlichen, enormen Ressourcenmobilisierung für die Seenotrettung und Menschenrechtsbeobachtung im Mittelmeer. Dank dieser Anstrengungen ist es bislang etwa noch jedes Mal gelungen, sechsstellige Beträge für neue Schiffe aufzutreiben, wenn die bisherigen von Italien, Malta oder Deutschland festgesetzt wurden. Gestorben wird auf dem Mittelmeer weiter – aber dank der Unnachgiebigkeit der NGOs nicht so still und unbemerkt, wie es sonst geschehen würde.
Das hat viel damit zu tun, dass die NGOs sich im Großen und Ganzen eben nicht, wie ihnen manchmal vorgeworfen wird, unreflektiert als »weiße Retter« aufspielen. Stattdessen machen sie durchgängig politisch zum Thema, was ihre Arbeit erst nötig macht: eine EU-Politik, die sich auch in dem neuem Migrationspakt nicht auf eine staatenübergreifende Seenotrettungsmission zu einigen vermag.
Wenn mit der gesellschaftlichen Mobilisierung und Akzeptanz vieles so gut läuft – warum wird dann flüchtlingsrechtlich gerade objektiv so vieles schlechter? Das ist auch eine Frage politischer Zyklen. Vor allem um 2018 herum sorgte eine erstarkte rechte und autoritäre Strömung dafür, dass die Aufnahme von Flüchtlingen möglichst eingestellt werden sollte; sie wollte ernst machen mit der »Festung Europa«, in die wirklich keiner mehr reinkommt. Der italienische Innenminister Matteo Salvini (Lega), die CSU auf dem Hoch ihrer Anti-Merkel-Phase und die österreichische Koalition aus ÖVP und FPÖ vor dem »Ibiza-Skandal« waren sich in dieser Hinsicht mit den Regierungen in Ungarn und Polen einig.
Mittlerweile ist dieses Bündnis zwar nicht zerbrochen, aber doch geschwächt und geschrumpft. Die dadurch etwas abgekühlte politische Stimmung hat Folgen. Italien schaffte die von Salvini eingeführten Millionenstrafen für private Seenotretter im Mittelmeer wieder ab und bekräftigte per Dekret ein Verbot, Flüchtlinge in seeuntauglichen Booten zurückzuweisen. Salvini selbst steht wegen des Vorwurfs schwerer Freiheitsberaubung vor Gericht, weil er 2019 Flüchtlinge nicht an Land gelassen hat.
In Österreich schoss sich die FPÖ mit der Ibiza-Affäre erst mal ins Aus – bei den Landtagswahlen in Wien Mitte Oktober verlor sie zwei Drittel ihrer Wähler. In Deutschland kippte kürzlich ein Gericht eine Verordnung, mit der Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Seenotrettungsschiffe lahmlegen wollte. Die AfD zerlegt sich selbst – auch durch allgemein gestiegenen Druck von außen. Die CSU nennt ihre Strategie von 2018 »falsch«, die AfD beim Asylthema rechts überholen zu wollen. Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung spricht von einer antipopulistischen »Trendwende im Meinungsklima«, auch, aber nicht nur veranlasst durch die Covid-19-Pandemie.
Das macht nicht alles sofort besser. Aber es eröffnet Möglichkeiten. Keine schlechte Grundlage, um politisch auch wieder in die Offensive zu kommen und den zuletzt sehr auf Moria verengten Blick etwas zu erweitern. Moria war zwar das größte Lager in der EU, aber nur einer von vielen Orten der Entrechtung von Flüchtlingen. Kaum gesprochen wird etwa über die Zurückweisungspraktiken an den kroatischen Grenzen. Diese Leerstelle versucht gerade unter anderem die Initiative »Balkanbrücke« zu schließen. Lohnend ist auch die Ausweitung von Netzwerken. In Griechenland etwa verfolgen Initiativen wie Diktio und City Plaza die Strategie, griechische Bürgermeister für die Aufnahme von Flüchtlingen von den Inseln zu gewinnen. Vom Netzwerk Seebrücke hatten sie bis vor kurzem noch nie gehört. Vor allem in Richtung Osteuropa dürfte sich eine stärkere Vernetzung lohnen: Vieles, was in Sachen Asyl in der EU im Argen liegt – etwa die mangelnde Aufnahmebereitschaft vieler Länder für im zentralen Mittelmeer aus Seenot Gerettete –, hat mit der Blockadepolitik Ungarns, Polens, der Slowakei, Sloweniens, Tschechiens und Österreichs zu tun. Damit sind in diesen Ländern keineswegs alle einverstanden, doch können sich die Kritiker bislang kaum Gehör verschaffen.
Sparen könnte man sich dafür getrost die Spendenaufrufe, jedenfalls für Moria. Viele NGOs, seriöse und nicht so seriöse, sammelten vor und nach dem Brand Geld und Sachspenden für die Menschen in den Lagern auf den Ägäis-Inseln. Ein Blick auf die Bilder aus dem neuen Camp auf Lesbos zeigt: Bei den Insassen kommt nur wenig davon an. Und das hat Gründe. Der griechische Staat hat seit 2015 fast 2,7 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge von der EU bekommen. Die Zahl der Ankommenden ist seit Mitte 2016 relativ überschaubar, die Mittel würden heutzutage vermutlich reichen, um die Neuankömmlinge auf Lesbos in Ferienwohnungen unterzubringen und mit Restaurantgutscheinen zu verpflegen. Das Elend dort ist kein Ergebnis eines Mangels an Geld. Was nicht heißt, dass Spenden für die Versorgung von Geflüchteten nicht eine wichtige Verbesserung der Lage bedeuten können, etwa in der syrischen Provinz Idlib, in Bosnien, dem Libanon oder anderswo. Die Ägäis-Inseln aber sind in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Das Elend dort ist die politisch gewollte Folge einer Entrechtung, die der Abschreckung dienen soll. Es lässt sich nicht mit Spenden, sondern nur politisch bekämpfen.




