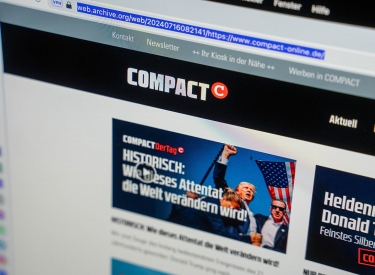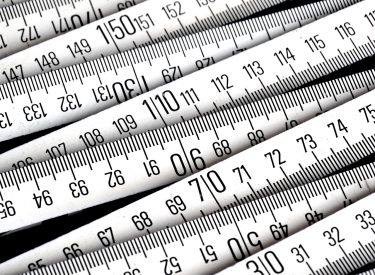Gefühlte Bedürfnisse
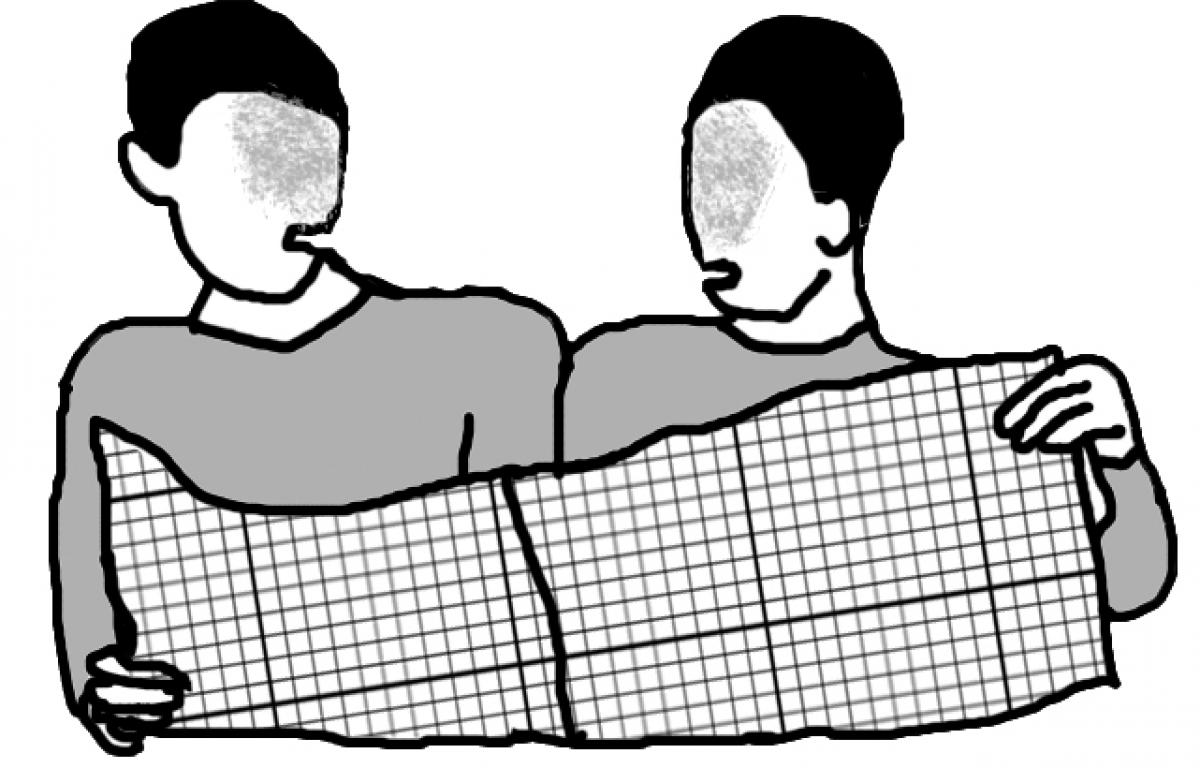 Vor einem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte.
Vor einem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte.
*
Die Autoren der bisherigen Disko-Beiträge haben recht: Die kapitalistische Vergesellschaftung ist schuld. Der Bäckermeister backt Mehrkornbrötchen und Simit, um sie verkaufen zu können, und nicht, damit wir sonntags was Leckeres zu mampfen haben. Weil das so ist, kommen viele Bedürfnisse nur in einer komisch verstellten Form zur Geltung: als Nachfrage. Es geht eben nicht darum, wer was will und wer was braucht, sondern darum, wer was zahlen kann.
Deshalb werden am laufenden Band neue Bedürfnisse produziert. Horden von Produktdesignern, Kommunikationswissenschaftlern und Marketingabteilungsleitern tun tagein, tagaus nichts anderes. Dabei können sie sich an kulturelle Milieus und den verschieden gut gefüllten Geldbeuteln der Leute orientieren. Werbung stimuliert Nachfrage, damit das Kapital was zum Produzieren und Absetzen hat.
Niemand muss bändeweise Marx lesen, um zu wissen, dass es in der Marktwirtschaft ums Geld geht. Das dürfte auch Celikates, Jaeggi, Loick und Schmidt klar sein, die die »11 Thesen über Bedürfnisse« geschrieben haben. Allerdings: Ihnen geht es um etwas völlig anderes. Sie wollen nämlich nicht über Bedürfnisse diskutieren, die das Kapital produziert. Stattdessen geht es ihnen um »radikale Bedürfnisse«, die »im Kapitalismus entstehen, aber ein systemveränderndes Potential haben – das Bedürfnis nach Solidarität, das Bedürfnis nach freier Zeit«. Diesen Gedanken borgen sie sich von Ágnes Heller, auf deren Buch »Theorie der Bedürfnisse bei Marx« an dieser Stelle schon Jan Rickermann hingewiesen hat.
Viele Süditaliener, die in den sechziger Jahren in den Norden gingen, hatten ihre Jugend in Dörfern fern der Fabrikgesellschaft verbracht und deshalb das starke Bedürfnis, ihr wieder zu entkommen.
Die Autoren der »11 Thesen« wollen, akademisch ausgedrückt, eine postmaterialistische, diskurs- und konflikttheoretische sowie radikaldemokratische Wende im Denken über Bedürfnisse. Das heißt im Klartext: Man soll bitte nicht meinen, Bedürfnisse gebe es einfach so. Gemeint sind hier nicht die Konsumbedürfnisse, sondern wie sich Leute das Zusammenleben vorstellen. Solche Bedürfnisse würden erst im politischen Streit entstehen. Der sei keine Diskussion beim Bier in ungezwungener Runde und auch kein Mehrheitsentscheid. Stattdessen sei Politik ein ständiger Kampf darum, welche Leute was wollen, warum sie das wollen und ob sie es durchsetzen können gegen diejenigen, die etwas anderes wollen. In diesem Kampf werde mit unfairen Mitteln gespielt, zum Beispiel mit Gewalt. Und weil das alles so sei, solle man sich politisch darauf stürzen, warum eigentlich der Christian das eine will und der Robert das andere und warum die Janine bestimmt nicht kriegt, was sie will. Oder in einem Satz: Nicht wie vorhandene Bedürfnisse befriedigt werden, ist politisch, sondern die Bedürfnisse selbst sind es.
An diesem Punkt sollte Kritik ansetzen – an der Idee, dass die ganze Welt durch politischen Kampf erzeugt sein soll. Um deutlich zu machen, warum dem nicht so ist, bedarf es eines kleinen historischen Schlenkers.
Der »Operaismo«, zu Deutsch: »Arbeiterismus«
Radikale Bedürfnisse zu fördern, war mal eine sehr populäre Idee. In Italien ging sie zurück auf den »Operaismo«, zu Deutsch: »Arbeiterismus«. Die Theorie wurde Anfang der sechziger Jahre von italienischen Marxisten um Raniero Panzieri und Mario Tronti entwickelt, die sich von der Kommunistischen Partei Italiens losgesagt hatten. Es ging ihnen um eine Kritik der Arbeit und der Fabrikgesellschaft, also darum, wie man zugerichtet wird, wenn man täglich am Fließband steht. Zur Bewegung wurde der Operaismo ein paar Jahre später, sein Symbol wurden die Massenstreiks bei Fiat in Turin 1969, seine Parole die Arbeiterautonomie.
Nanni Balestrini, der Schriftsteller-Chronist der italienischen Linken, hat dem Operaismo in seinem Buch »Wir wollen alles« ein Denkmal gesetzt. Und erklärt, woher der Erfolg des Operaismo kam: Viele junge Männer, darunter er selbst, zogen in den sechziger Jahren aus dem wenig entwickelten Süditalien in den Norden. Dort gab es Arbeit und die Aussicht auf ein besseres Leben. Schnell merkten sie aber, wie unerbittlich die Maloche in den Fabriken war und dass sie mit ihrem Lohn kaum auskamen. Der Operaismo, die Kritik der Fabrikgesellschaft, passte zu dieser persönlichen Geschichte. Vielleicht half auch, dass er genau genommen gar keine Theorie war – er war einfach gegen die Arbeit und für die Arbeiter. Uli Krug hat den Operaismo deshalb einmal treffend als »proletarische Lebensphilosophie« bezeichnet. Sein Programm lautete »Vogliamo tutto« – »Wir wollen alles«.
»Wir wollen alles«
»Wir wollen alles« hieß auch die Zeitung, die deutsche Linksradikale von 1973 bis 1975 herausbrachten. An ihr wirkten Gruppen wie die »Arbeitersache« aus München, der Frankfurter »Revolutionäre Kampf« und die »Proletarische Front« aus Hamburg mit. Sie versuchten Anfang der siebziger Jahre, den Operaismo in die Bundesrepublik zu bringen. Viele von ihnen waren schon ab 1967 in der Protestbewegung aktiv. Einige hatten die radikalen Bedürfnisse der Drogensüchtigen und Heimkinder fördern wollen. 1969/1970 begaben sie sich auf die Suche nach dem Proletariat.
Die deutschen Arbeiter enttäuschten sie aber: Sie hatten wenig Lust auf Rebellion gegen die Fabrik. Ihnen fehlten scheinbar die radikalen Bedürfnisse. Deshalb hielten sich zumindest die Frankfurter nach und nach stärker an die Hausbesetzer- und Jugendzentrumsbewegung – und wurden zu den sogenannten Spontis.
Radikal wirkten die Schüler, Studenten und Auszubildenden, die sich nach Orten sehnten, an denen sie sich fern von der Kontrolle durch Eltern und Lehrer austoben konnten. Zur Wahrheit gehört auch, dass große Teile der Frankfurter Spontis von Militanz begeistert waren, also radikale Bedürfnisse immer dort vermuteten, wo die meisten Steine flogen. Ende der siebziger Jahre entdeckten große Teile der Frankfurter Szene schließlich ihre ganz eigenen Bedürfnisse. Sie eröffneten Kollektivbetriebe und bekamen Kinder. Die Geschichte der Spontis ist eine lange Jagd nach radikalen Bedürfnissen.
Zeitkäfig Westdeutschland
Hält man den italienischen Operaismo und die deutschen Spontis nebeneinander, dann sieht man: Bedürfnisse nach einem angenehmeren Leben werden nicht erst in politischen Auseinandersetzungen erzeugt. Sie sind schon da, bevor jemand zum Agitieren vorbeikommt. Bedürfnisse entstehen durch die Erfahrungen, die Menschen machen. Viele Süditaliener, die in den Norden gingen, hatten ihre Jugend in Dörfern fern der Fabrikgesellschaft verbracht und deshalb das starke Bedürfnis, ihr wieder zu entkommen. Darum waren sie empfänglich für den Operaismo.
An den deutschen Arbeitern bissen sich die Spontis die Zähne aus – mit denselben Parolen und Strategien. Ihr eigenes Bedürfnis, alles umzuwerfen, hat Dan Diner einmal damit erklärt, dass sich das Westdeutschland der sechziger Jahre für junge Menschen wie ein »Zeitkäfig« angefühlt habe: Der Massenkonsum beschleunigte das Leben, die dadurch freigesetzte Lebensenergie traf aber auf den gefühlten Stillstand des Kalten Kriegs.
Zurück zu den »11 Thesen«. In ihnen steht, es gebe »kollektive Prozesse der Bedürfnisproduktion«. Die gibt es nicht – außer man meint damit die Arbeit der Produktdesigner, Kommunikationswissenschaftler und Marketingabteilungsleiter. Was es gibt, das sind Verwundungen, die das Leben den Menschen zufügt. Aus ihnen entstehen Bedürfnisse nach einem anderen Leben. Die werden nicht politisch ausgehandelt, sie werden gespürt. Mit etwas Glück lässt sich manchmal aufklären, woher sie kommen.
In den »11 Thesen« steht von all dem nichts. Dort gibt es keine lebendigen Menschen aus Fleisch und Blut und Schmerz und Angst und Hoffnung und Glück. Sie werden ihrer menschlichen Regungen beraubt, zu Knotenpunkten politischer Konflikte gemacht. Dabei ist es ganz einfach: Bedürfnisse sind nicht politisch, sie sind geschichtlich. Sie sind nicht diskursiv, sie sind leiblich.