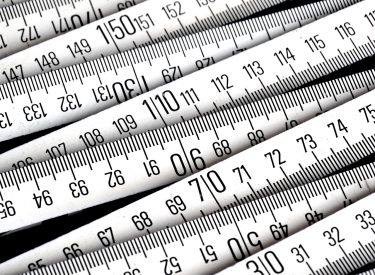Die Systemfrage stellen
Noch in der Silvesternacht wurde als Tatsache behauptet, dass 2 000 Nordafrikaner auf dem Weg zur Domplatte in Köln seien. Das konnte nur eine Machtprobe sein, das musste straff organisiert und geplant gewesen sein, das war also ein Vorgeschmack auf die Unterwanderung unserer Gesellschaft durch fremde, dunkelhäutige Männer. Aber nicht wenige Journalisten haben ihre Hausaufgaben gemacht und die kursierenden Zahlen genauer unter die Lupe genommen. »Die Zahl 2 000 stammt von der Bundespolizei. Sie bezieht sich (…) nicht alleine auf Nordafrikaner, sondern auch auf Syrer, Afghanen, Pakistaner und deutsche Männer«, hat Zeit Online recherchiert. Die Bundespolizei erfasste »170 Personen wegen festgestellter oder schon registrierte Straftaten oder gefahrenabwehrender Maßnahmen (…) Diese Menschen hatten jedoch 23 verschiedene Staatsangehörigkeiten, unter ihnen waren 56 Deutsche, 23 Syrer, 22 Algerier und 17 Marokkaner«. Die für den Kölner Hauptbahnhof ausgesprochenen 900 Platzverweise können (noch) nicht einer Hauptgruppe von Verhaltensauffälligen zugeordnet werden. Um es kurz zu machen: Weil nicht bekannt ist (Stand 9. Januar), wer genau sich auf den Weg nach Köln machte und warum, beruhen die aus den Zahlen gewonnen politischen Schlussfolgerungen auf Spekulation. Und die verrät mehr über den, der spekuliert, als über den Sachverhalt.
Unbekannt und geradezu ungeheuerlich ist weiten Teilen der Öffentlichkeit die Annahme, dass die Polizei racial profiling betreibt. Die Polizei habe doch »nur« beziehungsweise »endlich« ihre Arbeit getan und »uns«, insbesondere »unsere Frauen und Kinder«, geschützt. Sie habe dabei so gehandelt, wie sie auch bei Fußballspielen handelt, bei denen die Fans der gegnerischen Mannschaft am Bahnhof eingekesselt und dann in eigens gecharterten Bussen zum Stadion gebracht werden. Der Autor dieser Zeilen hatte darauf einmal keine Lust, steckte den Vereinsschal unter den Pullover, ging zur Polizei, sagte: »Schauen Sie, ich bin doch gar kein Fußballfan« und wurde herausgewinkt. Wie vielen der als »nordafrikanisch« identifizierten Männern wäre Vergleichbares (nicht nur) an Silvester gelungen? Die Frage ist rhetorisch.
Was jahrelang nur auf autonomen Plena geraunt wurde, ist nun öffentlich: Die Polizei betreibt racial profiling, mit Verweis auf die Sicherheitslage und die Fremdheit dieser Männer im Allgemeinen und mit der Erinnerung an die Silvesterübergriffe des vergangenen Jahres im Besonderen ist das jetzt erlaubt. Das stigmaisierende Wort »Nafri« wurde in der Öffentlichkeit lanciert – ob aus Unachtsamkeit oder politischer Absicht, macht keinen Unterschied –, damit man sich schon mal daran gewöhnen kann. Der Orwell’sche Neusprech für racial profiling lautet »Kollateraldiskriminierung«, für die, so Zeit-Redakteur Bernd Ulrich in einem Tweet, »die letztjährigen Täter verantwortlich sind«.
Bekanntes und Unbekanntes waren in der erregten Debatte nach Silvester vertauscht, zumindest für ein paar Tage, dann waren es Journalisten – und nicht etwa Vertreter von Politik und Polizei –, die die Fakten angemessener sortierten. Ein gewisser kritischer Reflex funktioniert noch, aber beruhigend ist das nicht. Denn was da vertauscht wurde, sind keine an sich neutralen Fakten. Die Staatsgewalt konnte damit durchkommen, einen Zustand herbeigeführt zu haben, in dem Grundrechte faktisch außer Kraft gesetzt sind. Die Legitimationsbasis scheint schier unerschütterlich: Sicherheit geht vor. Wer hätte was dagegen einzuwenden? Aber wenn es zu dieser Frage kommt, ist bereits einiges schiefgelaufen. In der Sicherheitsdebatte nimmt die Polizei die Stelle eines eigenständigen gesellschaftlichen Akteurs ein, der sich unmittelbar auf die Norm »Sicherheit« berufen kann und als ihr Vollstrecker dasteht. Im liberalen Verständnis ist die Polizei aber kein solch eigenständiger Akteur, sondern in politischen und sozialen wie privaten Auseinandersetzungen allenfalls die ultima ratio. Oder noch nicht mal das: mehr eine Hilfstruppe, die in verkeilten Situationen temporär zum Einsatz kommt.
Wieder einmal hat sich dieses liberale Verständnis als Illusion erwiesen. Noch bestehen Teile der Öffentlichkeit recht nachdrücklich auf dieser Illusion: Der Polizei wird eine Nafri-Debatte aufgedrückt, das Wort schickt sich nicht. Die Polizei entschuldigt sich für die unbedachte öffentliche Verwendung – und macht damit indirekt klar, dass Internes intern bleibt. Niemand ist so naiv anzunehmen, dass der »Nafri« aus dem Polizeijargon verschwinden wird. Der Debatte, welche Worte man öffentlich verwenden darf und welche nicht, liegt eine grundsätzliche Verschiebung zugrunde: Was die Polizei gemacht hat ist ja okay, sie hätte bloß das Wort »Nafri« nicht twittern sollen.
Für die Linke erwächst aus dieser Erosion eine doppelte Aufgabe. Was jahrelang keiner von Linken hören wollte, ist jetzt allen bekannt: Die Polizei arbeitet auch nach rassistischen Kriterien. Es steht zu befürchten, dass die jüngste Silvesternacht kein Ausreißer einer hypernervösen Staatsmacht war (Nervös? Man hatte ein Jahr, um sich vorzubereiten!), sondern ein Testlauf. Ein paar Journalisten nörgeln, aber die meisten gesellschaftlichen Akteure ziehen mit. Es wird nicht zuletzt an den Antifa- und Antira-Gruppen hängen bleiben, Fälle von racial profiling systematisch zu dokumentieren und zu skandalisieren. Sie machen den Job der ungeliebten Zivilgesellschaft, die sich in Selbstverrat übt, und müssen andererseits damit rechnen, dass unter den Leuten, für die sie Partei ergreifen, sich natürlich auch Machos, Gewalttäter, Schwulen- und Linkenhasser befinden.
Das ist klassische Bürgerrechtsarbeit mit all den bekannten, durchaus problematischen Folgen: Man professionalisiert sich, es entstehen Kontakte zur Politik und Medien, die für manche Aktivisten der Einstieg in die bürgerliche Karriere sein werden. Trotzdem, diese Arbeit muss gemacht werden. Ihr steht eine ganz andere Aufgabe gegenüber: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Systemfrage zu stellen. Die polizeiliche Restrukturierung des öffentlichen Raumes zeigt seine tiefe Krise an. Als geteilter Raum aller Bürgerinnen und Bürger stand er komplementär – aber immer wieder auch antagonistisch – zu ihren ökonomischen Partikularinteressen. Dass dieser Raum polizeilich, also über Ausschlüsse, Abgrenzungen, Beschwörung von Gefahren, Unterordnung von Fakten unter einen alarmistischen Neusprech etc. definiert wird, zeigt den Triumph dieser Partikularinteressen an.
Öffentlichkeit ist heute eine Angelegenheit des City-Marketings. Eine dermaßen verbaute Stadt wie Köln wirbt mit innerstädtischen Großevents, Partymeilen und Außengastronomie. Dafür will man ein zahlungskräftiges Publikum – und ein anderes eben nicht. Das ist die Stunde der Polizei. Die anderen – die Überflüssigen und Ungewollten – gibt es aber weiterhin, und sie wollen dahin, wo die Bessergestellten feiern, aus Übermut oder um was abzugreifen, und einige wenige (oder werden es schon mehr?) haben das dumpfe Verlangen, Rache zu üben. Die Angst, die sie verbreiten, erscheint als eine, die von außen kommt und uns als fremde Macht gegenübertritt. Sie kommt aber auch dem Inneren der Konsum- und Eventzonen selbst.