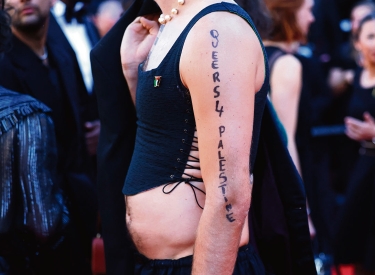Das Andere geht anders
Dem Kino gehen die Bilder zwar nicht erst seit gestern aus. Dennoch präsentiert es mit »Alien vs. Predator« einen neuen Höhepunkt cineastischer Düsternis. Als Vorgeschichte der vierteiligen »Alien«-Erzählung angelegt, zurück zu den Anfängen, wie es George Lucas mit seinen »Star Wars«-Filmen machte, findet dieser Teil ohne Commander Ripley statt. Auf die von Sigourney Weaver gespielte Figur, die bisher die aberwitzigsten Szenen (vor allem im vierten Teil) zusammenhielt, wurde hier verzichtet. Alien, das »Andere«, Kernbestand einer der einflussreichsten Science-Fiction-Kinoreihen, soll gegen ein ebenfalls außerirdisches Monstrum antreten, das es in einem beschissenen Arnold-Schwarzenegger-Film zu zweifelhaften Ruhm gebracht hat.
Mit den schönen Bildern von uns selbst, vermittelt durch das Andere, ist nun Schluss. Die dürftige Story: »Alien vs. Predator« berichtet aus einer Zeit 150 Jahre vor Beginn des ersten Teils von »Alien«. Der Milliardär Charles Bishop Weyland (Lance Henriksen) – der Schauspieler schlägt den dürftigen Bogen zu den anderen »Alien«-Teilen, er spielte dort den Androiden – hat eine große Tempelanlage in der Antarktis entdeckt. Um die unter der Eisoberfläche vergrabene Anlage zu erreichen und zu erforschen, trommelt er die weltbesten Wissenschaftler zusammen. Der alte Tempel ist Trainingsgebiet der Predators. Und genau diese Jäger sind auf dem Weg zur Erde, um in der Tempelanlage die letzten Aliens zu vernichten. Doch die haben, wo die Menschen einmal da sind, einen Weg gefunden, sich zu vermehren. Im Dustern fliegen ein bisschen die Fetzen und Schädeldecken. Mehr gibt’s nicht. Zum Schluss fliegen Atombomben auf wenige biologische Ziele – die Mini-Nuke-Produktlinie lässt grüßen (Armbandformat).
Vielleicht wäre in diesem Fall ein Alien-Film ohne Alien besser gewesen: Irgendwelche Fans hätten sich, so die Produktionslegende, nach einem Zusammentreffen der beiden Menschenjäger gesehnt. Als sei das Grund genug, den Alien-Topos zu zerstören, der kunstvoll durch mehrschichtig aufgebaute Filme entstanden ist. Produktionsmaschine »Mutter«, Gender-Krieg, Überleben im All, Funktionalisierung, First Contact, Suspense, Einsamkeit, Kapitalismuskritik, geniale Unterwäsche – alles vergessen: Die Popkultur gibt eben, und sie nimmt auch wieder.
Das Aufeinandertreffen der beiden Monsterkreaturen wurde zunächst als Computerspiel generiert; es soll auch als Kinofilm Gameboy-kompatibel bleiben für die vornehmlich jugendlich-männlichen Knallchargen. Dieser Mistfilm wird sogleich auf dem DVD-Markt landen, ist er doch nicht mehr als eine besser ausgestattete Spinnerei von Managementheinis, die mit der Alien-Mythologie nun Product Placement im eigenen Celluloid betreibt und in Regisseur Paul W. S. Anderson einen willigen Vollstrecker findet.
Eine Schande! Ach, es fehlen einem die Schimpfwörter.
Das sind Filme, die nicht gedreht werden müssen, weil sie bloß Schaden anrichten. Wie auch immer sich die Vorstellung von Zukunft entwickeln wird: Zu hoffen ist, dass ihr das gegenwärtige Science-Fiction-Kino nicht noch mehr Gestalt gibt.
jürgen kiontke
Alien vs. Predator (USA 2004). Regie: Paul W.S. Anderson. Start: 4. November