Lesen in vollen Zügen
Bahnfahren hat den Vorteil, dass man dabei Zeitung lesen kann. Ich packte also wie üblich die Bild und das ND aus, um meine Reisegefährten zu verwirren, aber auch, weil ich immer nach allgemeingültigen Wahrheiten suche. Die übrigen Reisenden lasen ihre Heimatzeitung. Das hat ebenfalls einen Vorteil. Man sieht auf einen Blick, wo die Leute herkommen. Man sieht es einige hundert Kilometer weit, denn nichts liest der Mensch so lange wie seine Heimatzeitung. Vermutlich möchten sie so lange wie möglich in der Heimat bleiben.
Die Fahrt selber folgte den allgemeinen Gesetzen der Monotonie. Ich zischte wie üblich zwei Pils vom Fass im Bord-Bistro und ging dann durch den Zug, um die liegen gebliebenen Zeitungen zu lesen, was immer sehr lehrreich ist. Was die Mediziner noch üben, haben die Zeitungsverleger längst erfunden – das Klonen. Alle ereiferten sich zum Beispiel darüber, daß eine gewisse Ulla Berkewicz sich in Zukunft nicht mehr von einem halben Dutzend alter Männer reinreden lassen möchte, wenn sie einen der langweiligen Romane von Martin Walser oder Peter Handke ins Programm nimmt. Frau Berkewicz scheint wenigstens schön zu sein. Die meisten Verleger sind nicht einmal das.
Aber noch einmal auf Anfang. Ich hatte also den Ärger mit den herunterfallenden Reisetaschen hinter mir und saß mit drei Damen und zwei Herren in einem winzigen Abteil. Alle fünf lasen die Stuttgarter Zeitung. Das lenkte mein nimmermüdes Gehirn zu der Frage, warum sich alle fünf eine Zeitung gekauft hatten und noch dazu dieselbe. Warum kaufte nicht eine Dame eine Zeitung und las den anderen vor? Warum ließen sie nicht eine Zeitung reihum gehen? Warum gibt es keine Ich-AG , die für eine kollektive Nutzung des Papiers sorgt?
Im Knüll klingelte es. Ich hatte meinen Reisewecker angeschaltet, tat aber unbeteiligt, als das Geklingel begann. Die folgende Szene wurde deshalb mit Blicken ausgetragen, die sich in die Worte kleiden ließen: »Ich glaube, Ihr Telefon klingelt.« Sofort holten alle ihre Telefone hervor, um ihre Unschuld zu beweisen, denn obwohl im letzten Jahr 136 Millionen Handys verkauft wurden, ist es beim Bahnfahren unfein, ein solches Gerät zu besitzen. Später schauten meine fünf Reisegefährten zu, wie ich meinen Wecker suchte und meine Intimbekleidung sortierte. Das war ein schöner Zug der Bahn, die aber auch Nachteile hat. Meine Tochter Leo (14), die immer froh ist, wenn man sie für einen Jungen hält, meinte nämlich, es wäre schneller gegangen, wenn ich die drei Kilometer zum Bahnhof zu Fuß gegangen wäre, statt ein Online-Ticket zu kaufen, wofür ich etwa zwei Stunden brauche, aber das sind Bagatellen.
Generell ist das Bahnfahren viel zu bequem geworden. Ich denke mit Wehmut zurück an die Kindheit, als wir in offenen Güterwagen durchs Land reisten. Alle paar Stunden hielt der Zug auf freier Strecke, wurden die männlichen Fahrgäste mit Äxten bewaffnet, stapften sie in die Wälder, um Brennholz für die Lok zu schlagen. Das waren noch Zeiten.
peter o. chotjewitz
Anderer Zielbahnhof
Sehr geehrter Personenschaden, in wenigen Durchsagen erreichen wir eine ontologische Zwischenannahme, wonach die Welt monistisch ist. Einst leuchtete die Gegend unverschneit, lag erwartungsvoll grünend im Sonnenlicht und der Eisenmeister war noch nicht über die geschwärzte Kanalbrücke in die geschäftige Stadt getreten, um dort den Intercitypfosten einzupflanzen, wo die Pferde gewechselt werden müssen, seit es Komfortabteile gibt, deren Scheiben zittern, wenn die Leute einander vor lauter abruptem Bremsen auf offener Schiene vor die Füße fallen. Tut mir leid, jetzt habe ich mich auf Ihren Disc-Man gesetzt. Das bringt die Menschen einander näher, wobei man sich dann bloß fragt, ob sie nicht Schläge mit dem Dampfhammer bevorzugen täten.
Friss was, anmaßender Passagier, es bringt dich auf andere Gedanken! Eine nahrhafte Suppe sitzt verängstigt in der Service-Mikrowelle, diese bedient Sie gerne von vorn und von hinten. Zack, Zunge verbrannt, macht vierzig Euro! Wir bitten um Ihr Verständnis, wir bitten um Ihr Wirrwarr von Eisen in jedem Stadium und einer unendlichen Verschiedenartigkeit von Formen, Achsen, Rädern, Zapfen, Kurbeln, Schienen. Alle anderen Anschlüsse können leider nicht warten, der Querbus nach Vietnam ist über Stalingrad auf der Höhe von Afghanistan unterwegs verloren gegangen. Durst? Nesquik ist aus, Personalwechsel, geben Sie Ihre Fahrausweise her, die werden dann gedreht und gepresst, bis eine Art ölschwarzer Orangensaft herausquillt.
Was meint der Mensch, wenn er sagt, er verstünde nur Bahnhof? Subjektive Bilder, subjektive Ideen lagern im Bewusstsein ein, Regeln der Korrespondenz mit objektiven Dingen und objektiven Beziehungen in der Domäne der trägen Materie treiben es wild im Schlafwagen, wo bis zu drei Betten für sie abgekocht und eingesaut werden dürften ohne Voranmeldung. Wir werden Sie über weitere Probleme nicht informieren, am Arsch.
Unser Hörspielprogramm in diesem fahrbaren Gefängnis liefert heuer ausnehmend unappetitliche Geschichten zum Thema »Blutvergiftung«, auf dem anderen Kanal kommt Klassik und Grindcore, übersteuert und zu schnell abgespielt, ist das nichts? Im Aschenbecher steigt ein Feuerwerk, legen Sie das Ohr dran, horchen Sie nur, wie es britzelt und zärtlich zerplatzt!
Soeben sind Brezeln zugestiegen, die Sie jetzt berauben werden. Bitte halten Sie den Mund, während wir Ihnen mit vorgehaltener Waffe eintrichtern, wieso die Privatisierung alles besser macht. Verstellen Sie Ihren Sitz vor der Landung, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Solange Sie Ihre Füße unter unseren Klapptisch quetschen, wird gemacht, was der muskulöse Mann mit der Neandertalerstirn will. Karte noch mal her, Klonwechsel. Reisepaß bittesehr, wird auch abgeknipst, und das Foto von den Lieben, und die EC-Karte, will alles markiert sein. Sie sehen gar nicht aus wie auf der Bahncard! Wohl im Erdloch übernachtet? Draußen droht bereits Hannover, Expo-City, ah, die digitale Stationsmeldung: »Hal-lo. Ich-bin-ein-Com-pu-ter-ton-und-noch-mo-der-ner-wie-die-gan-ze-rest-li-che-Bahn-er-fah-rung.« Flucht!
Weiterfahren, nur weiter, immer weiter, bis zum Rand des Regenbogens, bis zum dunklen Funkloch Gottes, bis die letzte T-Card vertelefoniert ist. Was passiert mit dem Fahrgast nach dem Tod? Wird zerhackt, in Zucker getaucht, vom Hund glattgeschleckt, in Cellophan verpackt und als Backstückchen im Bistro verkauft.
Verbindung ausdrucken?
dietmar dath
Kennen Sie Pößneck?
Kennen Sie Pößneck? Keine Sorge, ich bis vor kurzem auch nicht. Einmal leitete mein Verlag jedoch eine Einladung zu einer Lesung in diesem Pößneck an mich weiter. Die Kohle stimmte, und der Zusatz »liegt in Thüringen« ließ keine allzu ewige Fahrt vermuten. Und der Veranstalter versprach, pünktlich um 19.07 Uhr am Bahnhof zu sein. Wunderbar.
Ich kam zwar nicht um 19.07 Uhr in Pößneck an, sondern um 19.47 Uhr – für zwei Lokschäden und einen »Stellwerkschaden« fand ich vierzig Minuten Verspätung eigentlich noch ganz ok – aber leider sah ich weit und breit auf dem »Bahnsteig« niemanden mit Lodenmantel, Nickelbrille, Krawatte mit Büchermotivik oder wie Veranstalter gemeinhin so auszusehen pflegen. Der Bahnsteig war ein nicht überdachter Bretterverschlag an einer Schnellstraße. Es schneite. Es hagelte. Es war kalt. Eben war doch noch ein Anruf auf meine Mailbox erfolgt: »Tut mir leid mit der Verspätung für Sie – warte trotzdem.« Dennoch: Niemand da. Ich griff zum Handy. Selten hatte ich meine frühere Ablehnung der Mobiltelekommunikation so unverständlich gefunden wie in diesem Moment, wo inzwischen Männer neben der Schnellstraße anhielten und mich offenbar für eine Vertreterin des horizontalen Gewerbes hielten und Hagelkörner dutzendweise auf meinem Kopf fielen.
Die übelsten Typen musste ich mir jetzt genau anschauen, weil ich jeden für den Veranstalter halten musste. Dieses Anstarren wurde total falsch ausgelegt und mit aufgeräumtem Zähneblecken beantwortet: »Ich bin der Kurt. Was kostet denn einen Blasen bei dir?« Es wurde dunkler. Meine Lesung würde genau jetzt anfangen. Jetzt endlich klingelte mein Engel von Siemens:
»Wo-sind-Sie-denn, Frau Dückers??« Ein heiseres Hauchen zurück: »In-Pöß-neck!«
»Ach, Frau Dückers … Sie stehen bestimmt am Nordbahnhof … ich hab vergessen, Ihnen zu sagen, dass es hier zwei Bahnhöfe gibt … tut mir leid … in fünfzehn Minuten bin ich bei Ihnen!« Sprichts und legt auf.
Nach dieser fundamentalen Erweiterung meines geographischen Horizonts – Pößneck in Thüringen hat zwei Bahnhöfe! – sollten jedoch noch weitere Katastrophenreisen mit der Deutschen Bahn folgen.
Für meine nächste Lesung hatte ich praktischerweise meine Karten telefonisch vorreserviert. Ich dachte mir: besser als die stets überfüllte Schlange am »Express-Schalter« am Ostbahnhof. Kaum saß ich im Zug, näherte sich mir ein DB-Monster, das wie eine Kreuzung aus Kaiser-Wilhelm und einem Walross aussah. Der riesige Schnauzbart deutete schon auf Minderwertigkeitskomplexe und Machtgelüste hin.
»Da ham Se aba falsche Kaaten«, wurde ich angeraunzt. Ich piepste zurück: »Wieso? Bahncard 25, stimmt doch alles, oder?«, »Dit Daatum is vakeehrt. Heute is der 24.!!« Ich guckte auf mein Ticket. Das Walross hatte Recht: die elektronische Kartenverkäuferin hatte mir sinnigerweise mein Ticket für den falschen Tag ausgestellt. Ich hatte aber, meinen Kalender direkt vor mir, bestimmt den richtigen Tag geordert. Als ich freundlich versuchte, den Sachverhalt zu erklären, wurde ich angeherrscht: »Wollen Se mich va-arschen? Wir sind hier nich uffm orientalischen Basar! Dat könnense bei denen vasuchen, mich übas Ohr zu hauen, ja, uffm orientalischen Basar, da jehörn Se hin! Aba hier bei de Bahn müssen Se ’n neues Ticket kofen! Und zwar sofoart«
Und ich wurde – was mir natürlich kein Veranstalter erstattete – doppelt abkassiert.
Einmal saß ich im ICE, als eine ältere Frau aufgeregt auf mich zustürmte: »Ach, Sie erkenne ich doch … seitdem mein Sohn Ihren komischen Roman gelesen hat … diese … ›Spielwiese‹ … ›Spielwiese‹ heißt der doch … also seitdem …«, ihre Stimme wurde leiser und nahm einen drohenden Klang an: »Ist-er-bisexuell!«
Gutmütig wie ich bin, bestellte ich der aufgebrachten Dame einen Kaffee und erklärte ihr, warum, selbst für den Fall, dass ihr Sohn sich als homosexuell outen würde, die Welt noch die Welt und Kaffee noch Kaffee bleiben würde. Doch kaum hatte die Dame mich plötzlich ins Herz geschlossen, da hielt der Wagen mit einem krachenden Rumpeln sehr abrupt an. Eine Weile lang passierte nichts. Dann ertönte über den Lautsprecher: »Leider haben wir einen Personenschaden. Weiterfahrt vorerst unmöglich.« Da fasste mich die Dame am Arm und murmelte: »Das ist heute schon der zweite Selbstmord, immer an den Adventssonntagen springen die jungen Leute alle vor die Bahn. Die Jungen wollen heute nicht mehr leben. Entweder sie sind lebensmüde oder kriegen keine Kinder mehr, weil sie schwul sind. So ist das. Bekomme ich noch Ihr Autogramm?«
tanja dückers
Im Zugklo
»Jetzt in der Krise kann ich mir das Bahnfahren nicht mehr erlauben«, sagte mir Cosima von Bonin, einst erfolgreiche Künstlerin im Großraum Köln. »Welche Krise? Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr in der Krise«, zitierte ich Kerstin Grether (kennt jeder). Und bestieg den Zug nach Hamburg. Ich hatte mich schön angezogen – das braune Jackett aus Schottland, die blaue Alsterhose, der Trenchcoat aus der Reinigung, die guten Budapester Schuhe: der Schaffner sollte mich für einen Reichen halten. Ich sprach ihn vor Fahrtantritt an.
»Nehmen Sie mich mit? Ich habe ein Problem mit dem Ticket!«
»Aber natürlich, das regeln wir im Zug! Steigen Sie ein, mein Herr!«
Ich stellte das Gepäck in die Gepäckablage in der Ersten Klasse und begab mich gemessenen Schritts in eine Toilette der Zweiten. Mit dabei: Hans Nieswandts Klassiker »DJ’s Tage, DJ’s Nächte«, sowie das neue Kursbuch vom Dezember 2003 mit dem Großthema »Wir 30jährigen«. Da fühlte ich mich sofort angesprochen, auch wenn ich die 40 schon bald erreichen sollte. Dazu noch die Bild, aber da stand diesmal nichts drin. Das war nur für die ersten fünfzehn Minuten, in denen man meist etwas aufgeregt war. Die Bild beruhigte. Weil es noch immer die gleichen großen schwarzen, rot unterstrichenen Buchstaben waren, die sie schon 1954 verwendet hatten. »Patrick Lindner: Ich dachte an Selbstmord«, war diesmal die Headline. Schon wesentlich kleiner die Nachricht, dass Saddam gefasst worden war. Klar, der Patti Lindner und sein Gedanke an Selbstmord, das war erschütternder als so eine News aus der fernen Politik. Ich las: »Saddam – hat seine Frau ihn verraten?« Sie hatten sein Handy abgehört. Saddam hatte im Erdloch mit seiner Frau telefoniert. Ich nahm mir vor, nicht mit der Nusi zu telefonieren, solange ich in dieser Klozelle saß.
Ich lehnte mich zufrieden zurück, betätigte die Spülung. Jemand rüttelte an der Tür. Ich griff beherzt zu Nieswandts großem Roman. Ein wunderbares Buch, das mich bis zum Zielbahnhof beschäftigen konnte. Als eingefleischter Inhaltist konnte ich über mögliche Stilschwächen des Autors hinwegsehen. Der Mann hatte etwas zu sagen! Nur darauf kam es mir an.
Nieswandt hatte Acid House am 3. Januar 1989 in einer Garage im Bergischen Land erfunden. Inspiriert wurde er von einer Acid House Party, die im Dezember ’88 von Caroline v. Nathusius, Joachim Lottmann und Dirk Scheuring gegeben wurde. Es war sozusagen der Sound zur Party, nachträglich. Deshalb verwandte er das Wort. Eric D. Clark war auch dabei und noch einer. Wenig später wurde Nieswandt die Nummer eins in der italienischen Hitparade und verkaufte eine Million Tonträger. Viereinhalb Jahre später wiederholte er den Erfolg in Südkorea. Ich legte das Buch weg. Großartig. Nun war ich Hamburg bereits näher als Berlin.
Zwischen den beiden Städten wurde nicht gehalten. Die Fahrkartenkontrolle musste eigentlich schon vorbei sein. Da mir inzwischen alle Glieder schmerzten, wagte ich es und verließ die Toilette. Ich schlenderte mit wachen Augen zur Ersten Klasse, in der Hand meine beiden Bücher und mein abgeschaltetes Handy. Ich sah keinen Schaffner und setzte mich. Vor mir saß ein Zivilist, den ich zunächst nicht wahrnahm und er mich wohl auch nicht. Ich nahm das Handy, schaltete es an und schrieb eine SMS an die Nusi. Dabei sah ich einmal kurz hoch und entdeckte, dass der zivile Mitreisende mir gegenüber jemand war, den ich kannte. Nämlich auch ein Schriftsteller. Ein Schriftsteller, der mit der Bahn reiste. Es war Rainald Goetz, und er hatte mich so wenig erkannt wie ich ihn, die ganze Zeit. Er kritzelte nämlich unentwegt kleine Notizen in sein kleines Schriftsteller-Notizbüchlein und war vollkommen mit sich selbst beschäftigt.
»Tz, tz …«, dachte ich nur, schrieb die SMS an Sevichen zuende und schlich mich an dem zuinnerst vereinsamt-Verzweifelten vorbei nach draußen. Das war kopflos von mir, denn ich rannte direkt dem DB-Teamleader in die Arme, dem ich am Bahnhof erklärt hatte, ich hätte ein Ticketproblem. Ich hatte das nur prophylaktisch gesagt, für den Fall, dass sie mich schnappen würden. Denn dann war ich kein Schwarzfahrer, kein lupenreiner, und konnte nicht vor Gericht gezerrt werden. Noch hatte der Teamchef mich nicht gesehen. Ich kehrte abrupt um und schloss mich ins nächste Klo ein. Dort wartete ich atemlos. Erst nach Minuten beruhigte ich mich und begann, das zweite Buch zu lesen, nämlich Holm Friebes und Kerstin Grethers Kursbuch-Opus »Wir 30jährigen«.
Holm Friebe war wie immer eine Bank. Profundes Wissen, die richtige Haltung, absolut uneigennützig und uneitel. Dieser Mann arbeitete noch für das Verständnis des Ganzen, ein echter Intellektueller. Ich wusste nun, wie all die 30jährigen draußen im Lande, die ich nicht kannte, tickten. Noch (!) besser gefiel mir Kerstin Grether. Ich war so begeistert, dass ich mein Handy einschaltete und meine Frau anrief, also die Nusi. Die war nämlich mit Kerstin befreundet. Ich erzählte ihr, wie toll der Text von der war. Ich glaube, ich vergaß dabei, leise zu sprechen. Ich sprach so laut, dass das DB-Wachpersonal mich hören konnte. Auch Saddam hatte im Erdloch – es war zugleich eine Art Funkloch – viel zu laut mit seiner Nusi, äh, seiner Frau geredet. Er hatte geschrien. Wie ich jetzt, denn der Zug fuhr ebenfalls gerade durch ein Funkloch. Fäuste schlugen hart gegen die Klowand. Vielleicht hatte auch Rainald Goetz den DB Team Chief Commander alarmiert. Goetz wusste doch, wie ich reiste. Wie eben Schriftsteller in der Eisenbahn so reisen, wenn sie nicht gerade Suhrkamp-Starautoren sind. Jedenfalls kamen die Greifer in mein mobiles Erdloch, nahmen mir Handy und Kerstin Grether ab und wollten Geld haben. Es war eine Toilette der Ersten Klasse, und so musste ich einen dreistelligen Eurobetrag entrichten. Genau gesagt 146 Euro und 20 Cent.
Als ich damit fertig war, stolperte ich demoralisiert zu der Stelle zurück, an der Rainald gesessen hatte. Er war nicht mehr da. Hätte ich mir denken können. Wie alle großen Schriftsteller war er paranoid. Paranoia war ein griechisches Wort und hieß auf Deutsch »Verfolgungswahn«. Er hatte mich bestimmt erkannt, als ich abgeführt wurde, denn da hatte es einen Tumult gegeben. Jetzt hockte er ängstlich auf dem Dach eines der alten IC-Waggons und klammerte sich fest, trotzte dem Wind. Er glaubte, dass wir uns so nicht ein zweites Mal begegnen würden. Ich kannte das schon. Schon beim letzten Mal war es so gewesen, bei unserer unverhofften Begegnung im Zug nach Zürich. Sowas war eben immer möglich, wenn zwei Schriftsteller mit derselben Eisenbahn unterwegs waren.
joachim lottmann
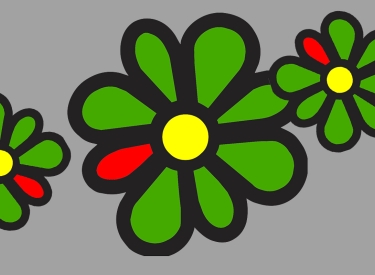
 Suche beendet
Suche beendet

