Right Here, Right Now
Vor e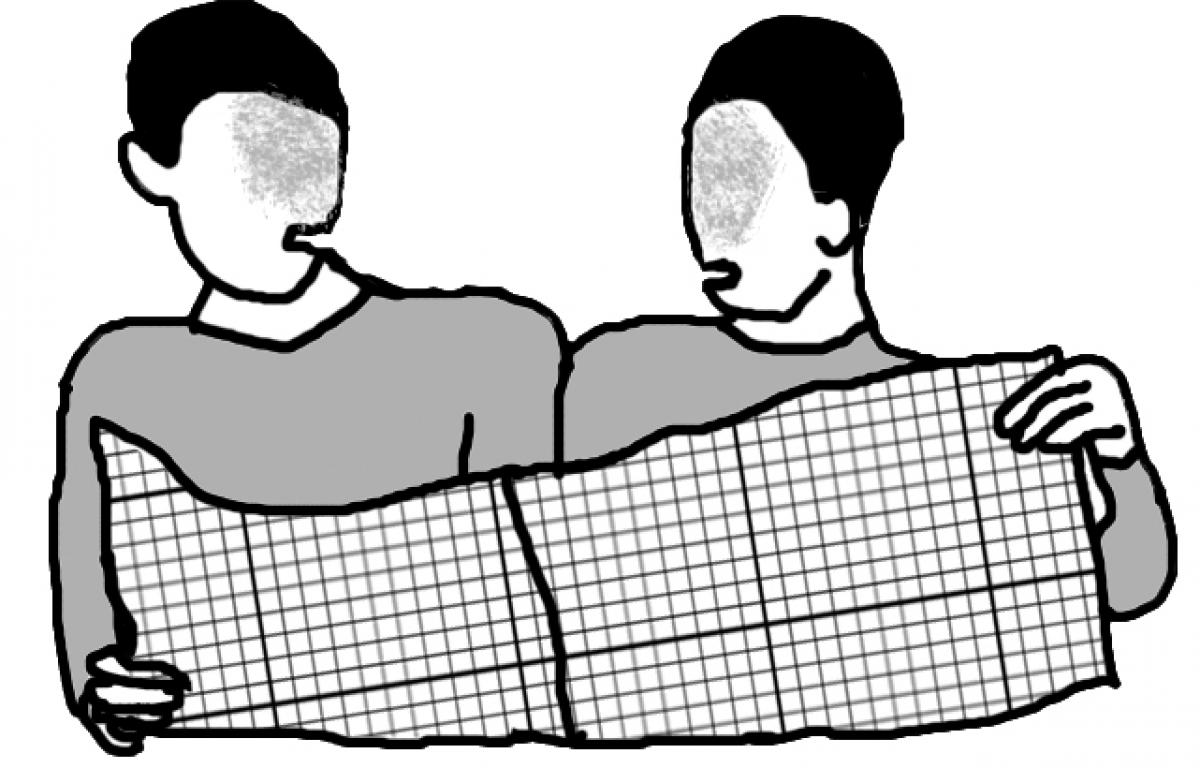 inem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte. Lucas Rudolph argumentierte, dass Bedürfnisse zuvorderst leibliche Regungen sind, die die Verhältnisse spiegeln (23/2024).
inem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024). Jan Rickermann (20/2024) meint, der Kapitalismus habe Bedürfnisse ermöglicht, die es nicht abzuschaffen, sondern zu befreien gelte. Lucas Rudolph argumentierte, dass Bedürfnisse zuvorderst leibliche Regungen sind, die die Verhältnisse spiegeln (23/2024).
*
Als 1942 der Kreis um Adorno und Horkheimer über Bedürfnisse diskutierte, war der Anlass die Entstehung des Wohlfahrtsstaats, der die kapitalistischen Gesellschaften in Europa und Nordamerika nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für rund 30 »glorreiche« Jahre prägen sollte. In den vierziger Jahren wurde das Programm dieser neuen Phase des Kapitalismus bereits vollmundig angekündigt. Der halbe Liter Milch am Tag für jedes Kind auf der Erde wurde zum Symbol dieser Politik, die in den USA Teil des New Deal war.
Die Vertreter der frühen Kritischen Theorie fragten sich in dieser Situation nicht nur, ob ein solches Programm realistisch sei. Sie fragten sich vor allem, was es für das Proletariat bedeutete, dass es nun mehr zu verlieren hatte als seine Ketten. Verloren die Ausgebeuteten und Unterdrückten durch die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse auch ihre Motivation, die Verhältnisse umzustürzen, und gliederten sie sich willfährig in die kapitalistische Gesellschaft ein? Was, wenn der Kapitalismus nicht nur verspricht, die Menschen aus dem Elend zu erlösen, sondern das auch tatsächlich vollbringt, ohne dass Herrschaft und Ausbeutung dadurch wanken?
Eine Politisierung der Bedürfnisfragen stellt die Grundlagen der kapitalistischen Marktwirtschaft in Frage, das ist keine bloße Utopie.
Eingelöst wurde das wohlfahrtsstaatliche Versprechen für die ganze Welt nie, aber dort, wo es verwirklicht wurde, entfaltete es eine erhebliche integrative Kraft. Dabei zeigten sich schnell auch seine Kehrseiten: bürokratische Bevormundung und der Zwang zu Arbeitsbereitschaft und Wohlverhalten. Und so wandelte sich in der Ära des Wohlfahrtsstaats nicht nur der Kapitalismus, es wandelten sich auch die Proteste gegen ihn. Das Aufbegehren gegen den sozialplanerischen Paternalismus wurde aber innerhalb kürzester Zeit selbst wieder zum Antrieb für eine weitere Epoche des Kapitalismus. Es wurde zum Teil der neoliberalen Erzählung. Der Wunsch nach persönlicher Autonomie, auf den Lucas Rudolph an dieser Stelle hingewiesen hat, wurde zum Vorwand, Steuern und Abgaben auf Kosten sozialstaatlicher Leistungen zu senken.
All das ist inzwischen Geschichte. Wenn heutzutage die Frage der Bedürfnisse wieder aktuell wird, dann zum einen, weil die ökologischen Krisen zeigen, dass der Kapitalismus dabei ist, die Grundlagen des Lebens weltweit zu zerstören. Und zum anderen, weil in Vergesellschaftungsdebatten versprochen wird, sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht länger am Profit zu orientieren. In beiden Fällen sind Bedürfnisse – ihre Berechtigung, ihre Dringlichkeit, die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Befriedigung – zentral.
Nichts hat sich geändert
Die alten Debatten haben sich deswegen keineswegs erledigt. Nichts hat sich daran geändert, dass im Kapitalismus neue Bedürfnisse nur produziert und Bedürfnisse generell nur befriedigt werden, um Mehrwert zu generieren – weshalb selbst das dringendste und elementarste Bedürfnis nichts zählt, wenn ihm keine Zahlkraft entspricht oder es dem Profit im Weg steht. Nichts hat sich daran geändert, dass soziale Sicherungssysteme für ihre Zahlungen Anpassung und Leistungsbereitschaft verlangen und dass Sozialprogramme häufig an den Zielen und Vorstellungen der Betroffenen vorbeigehen. Nichts daran, dass Freiheit immer noch vielfach ein Code für Schutzlosigkeit ist. Nichts daran, dass die Art und Weise, wie im Kapitalismus Bedürfnisse geschaffen und manipuliert werden, keine Rücksicht auf soziale und ökologische Belange nimmt. Nichts daran, dass die gesellschaftliche Integration nationalen, kolonialen und rassistischen Einteilungen folgt und Bedürfnisse dementsprechend sehr unterschiedlich befriedigt oder auch nur anerkannt werden.
Viele der Kritiken, an den von Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und mir veröffentlichten »11 Thesen über Bedürfnisse«, sind vor diesem Hintergrund zu verstehen. Ist es unter den gegenwärtigen ökonomischen Rahmenbedingungen nicht tatsächlich reiner »Utopismus«, wie Thomas Land an dieser Stelle vermutete, wenn wir dafür plädieren, die Auseinandersetzung um Bedürfnisse und ihre Befriedigung radikal zu demokratisieren? Fallen wir nicht all jenen in den Rücken, die um das Nötigste kämpfen, wenn wir es ablehnen, von Grundbedürfnissen zu sprechen, und stattdessen die Wandelbarkeit und gesellschaftliche Bestimmung von Bedürfnissen betonen? Käme es in den ökologischen Krisen der Gegenwart nicht darauf an, den Menschen als Teil der Natur mit natürlichen Bedürfnissen zu erkennen, um eine Kritik der verselbständigten Wachstumslogik zu untermauern? Stimmt es nicht, dass es gar keine falschen, kritikwürdigen Bedürfnisse gibt, sondern dass es darum gehen müsste, Verhältnisse zu schaffen, unter denen die Befreiung und Vervielfältigung der Bedürfnisse von den Vorgaben der Kapitalakkumulation befreit werden kann?
Der autoritäre Paternalismus der alten Wohlfahrtsstaaten
Die Forderung nach einer Politisierung der Bedürfnisse, nach ihrer Kritik und Bewertung widerspricht tatsächlich der gesellschaftlichen Realität. Aus liberaler Sicht gelten Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben als Fakten, die hinzunehmen sind. Doch wo zwischen Bedürfnissen und Vorlieben nicht unterschieden wird, wo beide nicht kritisier- und verhandelbar sind, da entscheidet tatsächlich die Kaufkraft, welche Bedürfnisse befriedigt werden, welchen Vorlieben entsprochen wird. Eine Politisierung der Bedürfnisfragen stellt folglich die Grundlagen der kapitalistischen Marktwirtschaft in Frage. Aber das ist keine bloße Utopie. Es geschieht hier und heute, wenn über die Verkehrswende diskutiert oder die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen gefordert wird. In diesen Bereichen finden gesellschaftliche Kämpfe statt. Und solche Kämpfe lassen sich nur vorantreiben, wenn der Marktlogik eine andere Logik der gesellschaftlichen Verhandlung über Bedürfnisse entgegengestellt wird.
Anders als auf dem Markt über Bedürfnisse zu verhandeln, meint aber häufig Expertokratie. Dazu zählt der autoritäre Paternalismus der alten Wohlfahrtsstaaten, zu dem auch die Planungsbürokratien des Realsozialismus zu rechnen sind. Fast noch populärer ist es gegenwärtig, das eigene Schicksal wissenschaftlichen Fakten zu überantworten. An die Stelle politischer Auseinandersetzungen tritt dann die Bestimmung des Menschen, seiner Natur und seiner Grundbedürfnisse. Von hier ist es nicht mehr weit bis zu Forderungen nach einer Ökodiktatur – dem »grünen Adolf«, von dem einst Rudolf Bahro phantasierte, oder dem grünen Lenin, nach dem heutzutage häufiger gerufen wird. Wir sprechen uns gegen solche reaktionären Auflösungen der Krisen und dafür aus, emanzipatorische Lösungen zu entwickeln. Die Voraussetzungen für solche Lösungen müssen in einer kapitalistischen Gesellschaft erst erkämpft werden. Sie entstehen aber auch nur in solchen Kämpfen. Selbst wenn der Kapitalismus den Menschen irgendwann nicht mehr einleuchten sollte oder gar an seine Grenzen kommt, werden emanzipatorische Lösungen nicht vom Himmel fallen.
Mehr für alle wollen
Dabei ist es wichtig, dass die Auseinandersetzungen, die heute um Bedürfnisse geführt werden, nicht unter dem Vorzeichen des Mangels und Verzichts stehen. In ihnen sollte es vielmehr darum gehen, Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Menschen zu organisieren. Der Kampf ums Überleben, sei es biologisch oder sozial, der im Bedürfnisbegriff oft mitschwingt (vor allem, wenn es um Grundbedürfnisse geht), bleibt natürlich existentiell. Aber für eine Menschheit, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts im Prinzip über die Mittel verfügt, alle existentiellen Notlagen auf der Erde zu lindern, kann die Forderung, diese Not auch tatsächlich zu überwinden, nur ein erster Schritt sein. Ziel muss es bleiben, die Rede von Bedürfnissen dort, wo sie das historisch und kulturell bestimmte Minimum des biologischen und sozialen Lebens beschreiben, hinter sich zu lassen und mehr für alle zu wollen.
Der Luxus, um den es geht, kann nicht darin bestehen, es immer mehr Menschen zu ermöglichen, im Privatjet nach Sylt zu fliegen. Aber er kann durchaus darin bestehen, Mobilität für alle zu ermöglichen, ohne den Planeten zugrunde zu richten.
Das heißt nun aber nicht, dass jedes Bedürfnis, jeder Wunsch und jede Vorliebe gleich zählen. Der Luxus, um den es geht, kann nicht darin bestehen, es immer mehr Menschen zu ermöglichen, im Privatjet nach Sylt zu fliegen. Aber er kann durchaus darin bestehen, Mobilität für alle zu ermöglichen, ohne den Planeten zugrunde zu richten. Ob es dabei hilfreich ist, von falschen Bedürfnissen zu sprechen, ist umstritten. Dass es gegenwärtig Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben gibt, deren Befriedigung nur noch mehr Elend produzieren, ist offensichtlich. Und nichts anderes meint »falsches Bedürfnis«: ein Bedürfnis, das den Menschen in Ausbeutung und Unterdrückung befangen hält.
Ágnes Heller – darauf hat Jan Rickermann hingewiesen – hat versucht, radikale Bedürfnisse als Kehrseite der falschen zu bestimmen. Radikal sind Bedürfnisse, die darauf zielen, die Verhältnisse umzuwerfen. Als ein solches Bedürfnis galt Heller der Wunsch nach mehr frei verfügbarer Zeit, weil es bei ihm darum geht, sich der Ausbeutung zu entziehen. Auch hier ist fraglich, wie weit dieser konkrete Ansatz trägt. Aber wenn man über radikale Bedürfnisse sprechen will, dann gehört zu ihnen sicher die Sehnsucht danach, über die eigenen Bedürfnisse, ihre Entwicklung und Befriedigung im Verein mit allen anderen frei entscheiden zu können.





