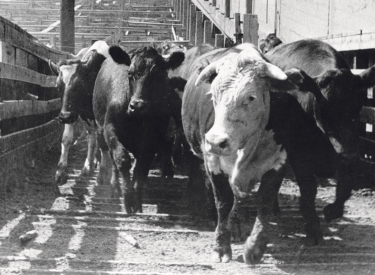Ewiger Kampf
Wer heutzutage kritische Gesellschaftstheorie im Anschluss an die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno begründete Frankfurter Schule betreibt, muss sich früher oder später für eine der zwei Strömungen entscheiden, die beide gleichermaßen im ursprünglichen Forschungsprogramm angelegt sind. Axel Honneth, von 2001 bis 2018 Direktor des Instituts für Sozialforschung, hat sie 1993 wie folgt zusammengefasst: auf der einen Seite Horkheimer und Adorno nach 1945, die »insgesamt einem marxistischen Funktionalismus verhaftet geblieben (waren), der sie dazu verführte, innerhalb der gesellschaftlichen Realität einen so geschlossenen Kreislauf von kapitalistischer Herrschaft und kultureller Manipulation anzunehmen, daß darin kein Raum mehr für eine Zone der praktisch-moralischen Kritik bleiben konnte«; auf der anderen die »Gegenbewegung zu den negativistischen Sozialtheorien« Adornos und Horkheimers, die objektive Maßstäbe der Kritik und die »Möglichkeit der Emanzipation« aus der »vorwissenschaftlichen Praxis« ableiten wollte.
Honneth entschied sich bekanntlich für den zweiten Weg: »Ohne den wie auch immer bewerkstelligten Aufweis«, so Honneth, »daß der kritischen Perspektive innerhalb der sozialen Realität ein Bedürfnis oder eine Bewegung entgegenkommt, läßt sich die kritische Theorie heute in keiner Weise mehr fortsetzen.«
Bis heute nehmen beide Richtungen jeweils für sich in Anspruch, das »eigentliche« Projekt der kritischen Theorie fortzusetzen. Zugleich ignorieren sich ihre jeweiligen Anhänger – nennen wir sie Pessimisten und Pragmatiker – seit Jahrzehnten mit den immergleichen Argumenten. Die Pessimisten, ausgestattet mit der unbesiegbaren Allzweck- und Wunderwaffe der »Totalität«, können die Pessimisten noch jeden vermeintlich progressiven, emanzipatorischen oder kritischen Impuls als Ausdruck und Bestandteil bürgerlicher Ideologie entlarven. Die optimistische Suche der Pragmatiker nach einem »Moment der innerweltlichen Transzendenz« sei nurmehr naiv. Damit, so die gängige Retourkutsche der Pragmatiker, bewahrten sich die Pessimisten zwar ihre reine Seele, änderten aber nichts am Status quo bestehender Herrschaftsverhältnisse.
»Aus der Perspektive unterdrückter, ausgebeuteter und marginalisierter Gruppen erscheint das Leben der Reichen und Mächtigen nicht unbedingt begehrenswert«, behauptet Loick kontrafaktisch gleich auf den ersten Seiten.
Der Honneth-Schüler Daniel Loick folgt eindeutig der pragmatischen Linie, die sowohl die normativen Grundlagen von Kritik als auch die sozialen Triebkräfte der Emanzipation den »vorwissenschaftlichen Instanzen« gesellschaftlicher Praxis zu entnehmen versucht. Freilich hatte Jürgen Habermas, der Vordenker des pragmatischen Zweigs, die kommunikative Praxis der Lebenswelt, die er als Quelle der Vernunft gegen die sich verselbständigenden Systemimperative von Staat und Kapital in Stellung brachte, ausdrücklich defensiv oder bestenfalls noch reformistisch verstanden. Ihm ging es darum, die Übergriffe einer rein instrumentellen Vernunft, also bloßer Zweckrationalität, auf die lebensweltlichen Bereiche des Privaten und die Sphäre der Öffentlichkeit abzuwehren – so jedenfalls seine berühmte Kolonisierungsthese.
Von einer Aufhebung der bürokratischen und kapitalistischen Systemlogik war dabei nie die Rede. Moderne Gesellschaften, so sein Argument, benötigten funktional ausdifferenzierte Systeme. Im Anschluss an Habermas verlegte Honneth die normativen Voraussetzungen des kommunikativen Handelns in den alltäglichen Kampf um Anerkennung – ohne jedoch die defensiv-reaktive Ausrichtung von Habermas’ Theorie in Frage zu stellen.
Die jüngeren Vertreter der kritischen Theorie blasen indes zum Angriff auf die kolonisatorischen Kräfte von Staat und Kapital. So auch Loick, der in seinem kürzlich erschienenen Buch »Die Überlegenheit der Unterlegenen« die Gegengemeinschaften in Stellung bringt. Sie agieren nicht nur in Distanz zu den bestehenden Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, sondern stehen in Konflikt mit diesen; sie wollen kein Teil der etablierten Ordnung werden, sondern diese umstürzen – so Loicks These.
Loicks revolutionäres Subjekt sind die »Verdammten dieser Erde«
Loicks revolutionäres Subjekt sind also die »Verdammten dieser Erde« (Frantz Fanon), die am meisten Marginalisierten, Ausgeschlossenen und Unterdrückten. Diese Überflüssigen, die nicht einmal auf ihre zukünftige Ausbeutung im Rahmen schlecht- oder unterbezahlter Lohnarbeit hoffen dürfen, müssen dementsprechend auch nicht länger gesamtgesellschaftlich verfügbar gehalten werden. Sie können sich selbst oder aber den »Vorrichtungen der organisierten Vernachlässigung« überlassen werden, worunter Loick beispielsweise die rassistisch überformte Masseninhaftierung in den USA oder die Internierung von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen versteht. Weil die »Surplus-Populationen« für das »biopolitische Regime« eines staatlich betreuten Kapitalismus keinen Nutzen haben, werden sie zum Gegenstand einer »Nekropolitik«, die den »vorzeitigen Tod« der Überflüssigen herbeiführt oder doch zumindest in Kauf nimmt.
Loick schließt hier von den negativen Konsequenzen einer sozialen Ordnung auf deren intendierten Zweck: Die Übersterblichkeit von (rassifizierten) Minderheiten sei die Folge davon, dass die »dominanten gesellschaftlichen Strukturen« zu eben diesem Zweck eingerichtet worden seien. Eine problematische Argumentationsfigur, die auch die Grundlage der Antirassismusstudien und Critical Whiteness Studies bildet.
Weil nun aber die Überflüssigen nicht auf die Hilfe der privilegierten Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft und »ihrer Ordnung« hoffen können, seien sie gezwungen, sich in Selbstorganisation eine eigene, alternative soziale Ordnung aufzubauen. In diesen »Gegengemeinschaften« machten die Ausgeschlossenen positive Erfahrungen zum Beispiel der Solidarität, die den Wunsch nach Inklusion in die etablierten, hegemonialen Institutionen und Strukturen allmählich absterben lasse. »Aus der Perspektive unterdrückter, ausgebeuteter und marginalisierter Gruppen erscheint das Leben der Reichen und Mächtigen nicht unbedingt begehrenswert«, behauptet Loick kontrafaktisch gleich auf den ersten Seiten von »Die Überlegenheit der Unterlegenen«. Denn das Leben der Gegengemeinschaften sei nicht nur anders, sondern letztlich sogar besser als das der Mehrheitsgesellschaft. Gegengemeinschaften seien zwar politisch, ökonomisch, sozial und kulturell unterdrückt, aber ihren Unterdrückern dennoch epistemisch, normativ, ästhetisch und affektiv überlegen.
Verallgemeinerung der gegengemeinschaftlichen Normen, Werte und Praktiken
Diese Überlegenheit der Unterlegenen dürfe man nicht mit der Romantisierung prekärer Lebensverhältnisse verwechseln. Weil die Überflüssigen vom Reichtum und von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind, ihnen also etwas Wesentliches vorenthalten wird, sind und bleiben sie Notgemeinschaften, die gezwungen sind, einen Zustand des Mangels zu verwalten. Es könne folglich nicht darum gehen, sich in den Gegengemeinschaften dauerhaft einzurichten und lediglich eine alternative soziale Ordnung aufzubauen. Der durch die soziale Unterdrückung ermöglichte »Zugang zu besseren Wissen, Werten, Ausdrucksweisen und Gefühlen« setzten die Unterdrückten dazu ein, die »Position des Beherrschtseins« zu verlassen.
Der zentrale Begriff in Loicks Buch ist darum auch der (abolitionistische) Kampf: Gegengemeinschaften kämpfen darum, bestehende Herrschaftsverhältnisse und damit zugleich ihre subalterne Stellung in diesen abzuschaffen. Das Ziel emanzipatorischer Politik besteht demnach nicht darin, die Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft für alle zu erfüllen, sondern in der Verallgemeinerung der gegengemeinschaftlichen Normen, Werte und Praktiken: »Es ist die Universalisierung der subordinierten, nicht die der dominanten Position in einer Herrschaftsrelation, die Befreiung ermöglicht.«
Die Überlegenheit gegengemeinschaftlicher Kollektive ergibt sich freilich nicht automatisch aus ihrer Unterdrückung, wie Loick wiederholt betont. Gegengemeinschaften sind lediglich potentiell, also der Möglichkeit nach, überlegen. Ihre Überlegenheit muss aktiv erarbeitet, oder besser: gegen interne und externe Widerstände erkämpft werden. Die Vorteile gegengemeinschaftlicher Werte, Institutionen, Praktiken, Subjektivierungsweisen und Beziehungen gegenüber denen der Mehrheitsgesellschaft seien »keine Gegebenheiten, sondern Errungenschaften«. Sie kämen nur solchen unterdrückten Gruppen zu, »die sich auf spezifische Weise zusammenschließen, organisieren und interpretieren«. Die Spezifik besteht letztlich in ihrer antagonistischen Ausrichtung gegenüber dem Bestehenden. Oder kurz gesagt: Erst das Gegen macht aus dem bloßen Anders ein Besser.
Konflikttheoretischer Formalismus
Mit Loicks »Primärsetzung des Kampfes« gelangt eine Entwicklung der kritischen Theorie an ihr logisches Ende, die von der Zurückweisung von Marx’ und Adornos Zentralstellung arbeits- und werttheoretischer Überlegungen über Habermas’ kommunikations- beziehungsweise Honneths anerkennungstheoretische Substitute hin zu Loicks konflikttheoretischem Formalismus führt.
Bereits Habermas konnte letztlich nicht erklären, warum ausgerechnet die lebensweltlichen Praktiken kommunikativer Vernunft, wie in zivilgesellschaftlichen Organisationen, bei öffentlichen Debatten, Protest oder zivilem Ungehorsam, progressiv und also in normativer Hinsicht »gut« sein sollen. Aus dem formalen Umstand sozialer Interaktionen jenseits bürokratischer oder kapitalistischer Systemlogiken lässt sich keine fortschrittliche Ausrichtung der Ziele der Akteure ableiten, wie das systemkonforme »bürgerschaftliche Engagement« oder regressive Vereinigungen innerhalb der Zivilgesellschaft beweisen.
In Loicks Analyse sind Kämpfe aber letztlich immer dann gerechtfertigt, wenn sie die »Formen der Naturalisierung sozialer Dominanz« dementieren – ganz egal, welche Ziele und Interessen jenseits dieser negativen Bestimmung noch mit ihnen verbunden sind. Am Ende erscheinen bei ihm nahezu alle menschlichen Aktivitäten als Kampf: »Eine Abtreibung durchführen lassen, im Kofferraum eine Grenze überqueren, Schulden haben, um die richtigen Worte ringen, Coming-out, keine Wohnung finden, Blaumachen, Corona kriegen, einen Dildo umschnallen, von der Polizei kontrolliert werden, zur Psychoanalyse gehen, eine Asthma-Erkrankung entwickeln – all dies sind nicht unbedingt politisierte oder intentional geführte, aber allgegenwärtige und unvermeidbare Weisen zu kämpfen.«
Inhaltlich komplett entleerte Kategorie der Konfliktizität
Die inhaltliche Abstraktion von den jeweiligen Gehalten der Kämpfe sei die Voraussetzung dafür, sie »zu einem gemeinsamen Transformationsprojekt zu verbinden« und eine wirkliche Gegenmacht zu entwickeln. Eben dafür bedürfe es eines politisch neutralen Begriffs des Kampfs, der breit genug sei, »um heterogene Erfahrungsdimensionen, Bewusstseinsinhalte und politische Ausrichtungen fassen zu können«.
Nur ein derart un- oder unterbestimmter Begriff des Kampfs ermöglicht es, dass jeder und jede zu einem potentiellen Bündnispartner werden kann. »Die Tatsache, dass ›jede:r kämpft‹, bedeutet, dass das Projekt der Entfaltung von Gegenmacht nicht (voluntaristisch oder moralistisch) an abstrakte Normen oder objektive Interessen appellieren muss, sondern sich auf eine in realen sozialen Praktiken verankerte, subjektiv erfahrbare Gemeinsamkeit berufen kann.«
Am Ende landet Loick bei einer schmittianischen Ontologisierung des Kampfs, der prinzipiell kein Ende kennt.
Mit der Aufwertung einer inhaltlich komplett entleerten Kategorie der Konfliktizität, die »rebellische Subjektivität« am Ende ausdrücklich nicht nur »für marginalisierte Minderheiten reservieren« möchte, widerlegt Loick am Ende des Buchs all das, was er vorher über die Bedeutung der Situiertheit der Unterdrückten geschrieben hat. Denn letztlich hängt es Loick zufolge vom Kampf und nicht von den sozialen Verhältnissen ab, ob man sich gegen die bestehenden Verhältnisse organisiert. Wenn es aber auf den bloßen Akt des Widerstands und die Unterbrechung der Routine ankommt, ist jeder Rückbezug auf marginalisierte Gruppen überflüssig; ein subjektives Dagegenhalten reicht aus, um beim gegenhegemonialen Projekt der Zerstörung des Status quo mitmachen zu dürfen.
Damit landet Loick am Ende dort, wo sich Chantal Mouffe, Judith Butler, Jodi Dean, aber auch die akademisch anerkannte sogenannte radikale Demokratietheorie mit ihrer Glorifizierung des Politischen befinden: bei einer schmittianischen Ontologisierung des Kampfs, der prinzipiell kein Ende kennt.
Dementsprechend schreibt Loick anknüpfend an Peter Weiss’ »Ästhetik des Widerstands«: »Der Kampf ist aber nicht in einem instrumentellen Sinne zu verstehen, als eine Strategie zur Überwindung des alten und zur Hervorbringung eines neuen Zustands, sondern als Existenzweise: als eine Lebensform, deren Sinnlichkeit und Verstand in jedem Moment auf einen möglichen anderen Zustand aufgespannt ist.«
Daniel Loick: Die Überlegenheit der Unterlegenen. Eine Theorie der Gegengemeinschaften. Suhrkamp, Berlin 2024, 297 Seiten, 24 Euro

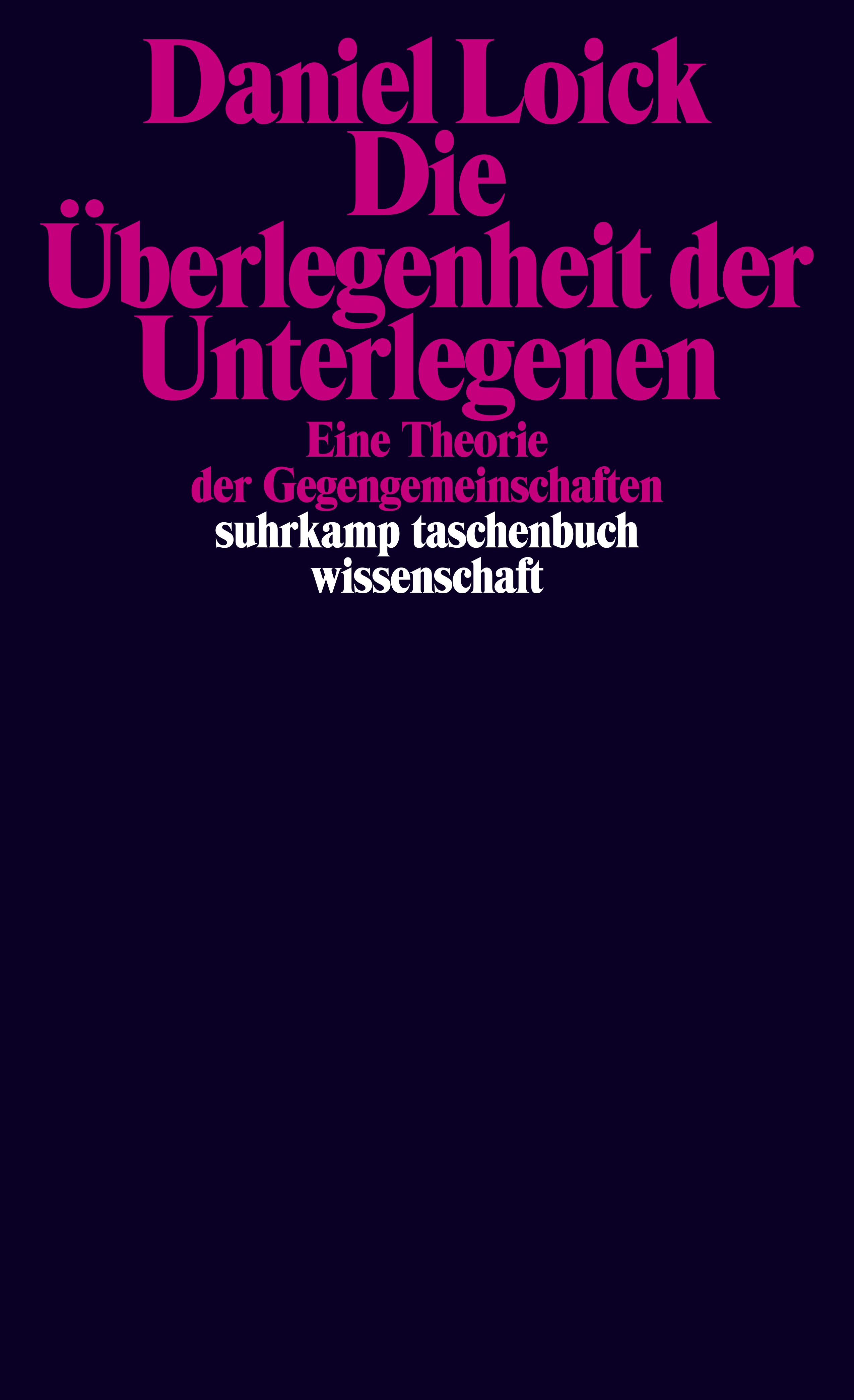


 Die Paraglider-Linke fliegt raus
Die Paraglider-Linke fliegt raus