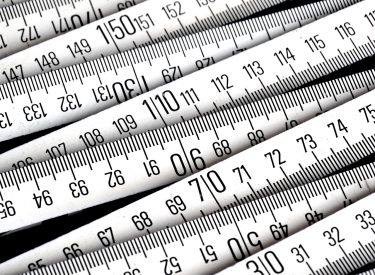Eine antiautoritäre DDR
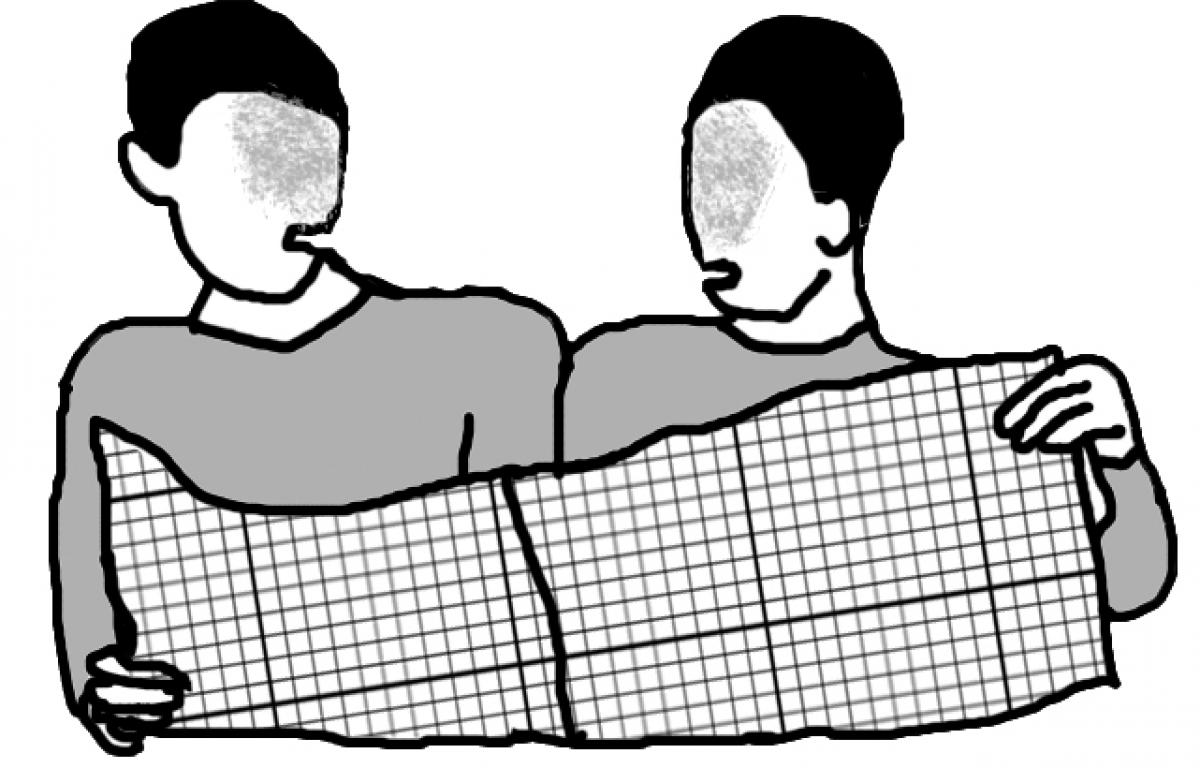 Wie kann die gesellschaftliche Produktion abseits von Lohnarbeit und Märkten organisiert werden? Felix Klopotek stellte das Konzept der Arbeitszeitrechnung der Gruppe Internationaler Kommunisten vor (23/2023). Philip Broistedt und Christian Hofmann argumentierten, dass dieses Modell eine kollektive Planung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ermöglichen würde (24/2023). Julian Bierwirth kritisierte, dass damit die Widersprüche und Zwänge der Warenproduktion nicht überwunden würden (25/2023).
Wie kann die gesellschaftliche Produktion abseits von Lohnarbeit und Märkten organisiert werden? Felix Klopotek stellte das Konzept der Arbeitszeitrechnung der Gruppe Internationaler Kommunisten vor (23/2023). Philip Broistedt und Christian Hofmann argumentierten, dass dieses Modell eine kollektive Planung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ermöglichen würde (24/2023). Julian Bierwirth kritisierte, dass damit die Widersprüche und Zwänge der Warenproduktion nicht überwunden würden (25/2023).
Viele Genoss:innen nehmen das Scheitern des Realsozialismus im 20. Jahrhundert nicht ernst. Sie kritisieren den Realsozialismus politisch, nicht politökonomisch. Sie kritisieren undemokratische und inkompetente Führung, schwache Anreize durch mangelnde Konkurrenz zwischen Betrieben oder Arbeiter:innen, Geld- statt Arbeitszeitrechnung oder verweisen auf fehlende Rechenleistung von Computer als Ursache für das Scheitern seiner Planwirtschaft. Aber die Kommandowirtschaft scheiterte, weil sie im Kern kapitalistisch war, da sie Arbeit durch Lohn erzwang und dadurch der (Tausch-)Wert herrschte. Sie war eine kapitalistische Planwirtschaft. Die Arbeitszeitrechnung (AZR) der Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) erinnert deshalb nicht nur an den Marktkapitalismus, wie Julian Bierwirth argumentiert, sondern auch an den Staatskapitalismus des Realsozialismus, nur mit demokratischem Anstrich.
Das AZR-Konzept wie auch neuere Ansätze von Paul Cockshott und Allin Cottrell (die neben Arbeitszeit wenigstens CO2-Emissionen als Planzahl aufnehmen), David Laibman und Pat Devine oder Robin Hahnel und Michael Albert halten am Arbeitszwang fest, denn »wir werden um gewisse Formen der Vergütung nach Leistung – zumindest fürs Erste – kaum herumkommen«, wie Philip Broistedt und Christian Hofmann an dieser Stelle geschrieben haben. Es scheint nur ein kleiner Fehler, ein »Muttermal« der alten Gesellschaft (Marx), ein (zumindest bei den antiautoritären Autor:innen) unbeliebtes, aber realistisch betrachtet unvermeidliches Zugeständnis an die kapitalistische Subjektivierung. Aber es ist viel mehr als das. Die Lohnarbeit zählt neben Klasse und Markt zu den Charakteristika des Kapitalismus.
Mit der Lohnarbeit – und dabei ist es zunächst egal, ob für Arbeitsscheine oder Geld gearbeitet wird – herrscht in der Planwirtschaft wie in der Marktwirtschaft der (Tausch-)Wert. Wie kann man dann behaupten, dass die AZR den »Wert aus der Welt« schaffe? Ja, wie der Realsozialismus schafft die AZR die betriebliche Konkurrenz ab und damit den Profitzwang, aber nicht den Wert. Der beherrscht weiter das Handeln der Subjekte.
Im Realsozialismus wie bei der AZR mag Arbeiter:innen und Betrieben der Gebrauchswert von Produkten und Dienstleistungen persönlich am Herz liegen, aber sie müssen sich am Tauschwert orientieren. Arbeit dient vorrangig der individuellen Existenzsicherung. Deshalb stritten die Lohnarbeiter:innen im Realsozialismus sehr vernünftig für Lohnsteigerung, Minimierung der Arbeitslast und hohe Boni. Der Gebrauchswert, fristgerechte Lieferung und Produktivitätssteigerung waren sekundär. Dabei standen sie im Gegensatz zum Planstaat. Dieser forderte gute Produkte, ehrliche Zahlen und Produktivitätssteigerung. Aber ohne die Disziplinierung der Konkurrenz verschleierten DDR-Betriebsdirektor:innen mit großem Erfolg ihre Leistungsfähigkeit und gewannen sogenannte weiche Pläne, die keine Höchstleistung der Betriebe erforderten.
Um dieses Problem zu lösen, kamen Forderungen nach mehr »materieller Interessiertheit« auf: mehr Einkommensdifferenzen, mehr leistungsbezogener Lohn, mehr Sanktionen für Betriebe, mehr Wettbewerb – letztlich die Rückkehr des Markts.
Natürlich ist die Minderung der Konkurrenz für Arbeiter:innen (geringe Einkommensdifferenz und keine Arbeitslosigkeit) und Betriebe (geringe Profitdifferenzen und keine Konkursmöglichkeit) sozialistisch, aber auf fortbestehender kapitalistischer Grundlage führt sie zu Ineffizienz. Diese ökonomische Sanftheit brach dem Realsozialismus zunehmend ökonomisch das Genick. Das war entscheidend, nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Westen, Parteiherrschaft und schlechte Planung.
Man hört schon die Genoss:innen rufen: »Aber bei uns ist das ganz anders.« Nein, ist es nicht. Die Arbeitszeitrechnung stellt gegenüber der realsozialistischen Geldrechnung, wie es sie beispielsweise in der DDR gab, keine echte Verbesserung dar. Auch das realsozialistische Geld war kein Marktgeld, niemand konnte damit Produktionsmittel kaufen und Kapitalist:in werden. Und auch rote Zahlen der Betriebe wurden akzeptiert, solange die Planerfüllung gelang. Es war vielmehr eine Recheneinheit, um Überblick zu bekommen und die Arbeiter:innen an den Lohn zu ketten. Auch die Selbstverwaltung der Betriebe macht die Arbeiter:innen nicht zu Kommunist:innen, weil sie es materiell nicht sind. Sie bleiben Lohnarbeiter:innen, die vernünftigerweise versuchen, möglichst geringe Leistungen erbringen zu müssen und ihren Konsum zu maximieren.
Auch im Realsozialismus stellte sich die Rede von einer ersten Phase, auf die dann die Errichtung des Kommunismus folgen würde, als ein leeres Versprechen heraus.
Der Realsozialismus war politisch autoritär, aber ökonomisch sanft – und die Internationalen Kommunisten sind schlicht die Sanften der Sanften. Hier versucht nicht der Staat, das Höchste aus den Betrieben herauszuholen, sondern die Betriebe schlagen Pläne vor und der Staat (Verzeihung, die öffentliche Buchhaltung, bei Lenin waren es vor der Machtergreifung auch die assoziierten Arbeiterräte) bewilligt sie. Damit haben Betriebe und Arbeiter:innen noch mehr Macht – in dem Sinn ist das Modell tatsächlich weniger autoritär – auf Kosten der Konsument:innen, sowohl der Endkonsument:innen als auch anderer Betriebe, die mit Mängeln und Lieferproblemen umgehen müssen. Neuere Modelle wie der Cybersozialismus von Cockshott und Cottrell sowie das Parecon-Modell (Parecon steht für »participatory economics«) von Robin Hahnel und Michael Albert vollführen die »Rückkehr des Marktes« schon im Konzept. Sie führen abgeschwächte Konkurrenz zumindest auf den Endgütermärkten ein. In der Praxis wäre man immer wieder gezwungen, entweder mehr Konkurrenz einzuführen oder mit dem ständigen Versagen der Planung zu leben.
Es gibt noch viele weitere Argumente gegen eine planwirtschaftlich organisierte sogenannte Übergangsgesellschaft, deren historische Versuche sich eher als etatistischer Pol des Kapitalismus entpuppten: Die Abspaltung der Sorgearbeit besteht fort. Die Tendenz zu autoritären politischen Formen wohnt der zentralisierten Wirtschaftsform inne (wobei immerhin die Herrschaft des Marktes beseitigt wird). Das Externalisierungsprinzip besteht fort, da Betriebe ihre Kosten senken, ohne auf ökologische Folgen zu achten. Die Klassenverhältnisse bleiben, in deren bestem Fall die Arbeiter:innen ihre Kapitalist:innen (im funktionalen, nicht ausbeutenden Sinne) selbst wählen. Die Ausbeutung besteht fort – allerdings nicht zum Nutzen der abgeschafften Kapitalist:innen, sondern zum gegenseitigen Nutzen der Arbeiter:innen, indem sie sich gegenseitig zur Arbeit zwingen (was Bierwirth »kollektive Selbstunterwerfung« nennt). Die Selbstentfaltung ist weitgehend auf Freizeit und Konsum beschränkt, während Produktion und produktive Bedürfnisse nach wie vor Entfremdung, Ausbeutung und Tauschwert unterworfen sind.
Eine demokratische Planwirtschaft kann mehr Gleichheit und mehr Sicherheit bieten, aber nach wie vor mit dem Zwang der Lohnarbeit, mit dem gleichen Gegensatz der Interessen, dem gleichen Versprechen des Konsums. Und da die Marktkonkurrenz brutal Konsum- und Kapitalmacht vor Arbeitermacht priorisiert, winken im Marktsystem Banane und BMW statt Mangelwirtschaft.
Warum also noch einmal Staatskapitalismus, wenn auch in demokratischerer Form? In den Ostblockstaaten wurde argumentiert, die Produktivkräfte seien noch nicht weit genug entwickelt, um zum Kommunismus überzugehen. Zwar ist das Argument generell zweifelhaft, aber heute ist es, was die technische Entwicklung angeht, aus der Welt. Und was die menschliche Seite der Produktivkräfte angeht: Die staatskapitalistischen Arbeiter:innen lernen in den Subbotniks (freiwillige Arbeitseinsätze) sicherlich nicht, »wie Kommunisten zu arbeiten« (Lenin). Das war idealistischer Kommunismus: Zuerst zwingt man die Menschen zur Arbeit und dann ist man verwundert, dass sie nicht freiwillig und motiviert (mehr) arbeiten. Wer Kommunismus will, muss materialistisch denken und die realen Bedingungen dafür schaffen: Verteilung nach Bedürfnissen statt nach Leistung und damit Freiwilligkeit statt Arbeitszwang. Dann regiert der Gebrauchswert.
Auch das alte Argument einer schrittweisen Einführung des Kommunismus ist Wunschdenken – wenn auch verständlich. Im Gegensatz zu einigen ihrer Vorgänger:innen wollen heutige Staatskapitalist:innen ein hohes bedingungsloses Grundeinkommen als Ergänzung des Arbeitslohns (die GIK nennt es den »Faktor individueller Konsum«, FIK), um die zuerst verordnete Gewalt abzumildern. Aber in der Praxis werden die Kommandosozialist:innen erfahren, was auch die Führungsschichten im Kapitalismus fürchten: Verlust des Kommandos über die Arbeit. In den USA ist die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen politisch völlig unten durch, seit die US-Regierung während der Covid-19-Pandemie ein vergleichsweise hohes an bedürftige Bürger ausbezahlte, und siehe da: Die arbeitenden Massen verhielten sich vernünftig und legten ihre miesen Jobs nieder. Die gleiche Einsicht blüht unseren kommandosozialistischen Genoss:innen. Man hört schon das Argument: »Leider kann das BGE doch nicht angehoben werden, da sonst die Produktion zum Erliegen kommen könnte.«
Auch im Realsozialismus stellte sich die Rede von einer ersten Phase, auf die dann die Errichtung des Kommunismus folgen würde, als ein leeres Versprechen heraus, und warum sollte es dieses Mal anders sein? Nein, beim Kommunismus heißt es »ganz oder gar nicht«. Er hat nicht eine humanere und vernünftigere Organisation des Kapitalismus anzubieten, sondern etwas ganz Neues, was bisher nur Wenigen vorbehalten war: die Freiheit, über die eigene Lebenszeit zu verfügen. Ein Ende von Selbstunterwerfung und Entfremdung, Zeit für Sorge, »travail attractif« (Marx), Raum für resonante, lebendige Weltbeziehung. Und noch etwas, das noch viel schwerer zu vermitteln ist und in commonistischen Keimformen aufscheint: Solidarität.