Die Suche nach dem apokalyptischen Echo
Dass »sogenannte Massenbewegungen faschistischen Stils mit Wahnsystemen eine sehr tiefe strukturelle Beziehung haben«, wie Theodor W. Adorno sagt, lässt sich kaum deutlicher als im Verhalten einiger Zeitgenossen im Allgemeinen und bei den Demonstrationen der »Coronaleugner« im Besonderen studieren.
Eine sehr einfache Erklärung für all das, man traut es sich kaum laut zu sagen: Diese Gesellschaft ist in großen Teilen in Vernunft, Moral, Geschmack und Kultur von der Pandemiekrise überfordert, und die Reaktion auf die Überforderung geht über den lunatic fringe, den Saum des Wahnsinns, hinaus, der sich um jede soziale Bewegung bildet. Das zumindest behauptete Theodore Roosevelt, der meinte, jede Reformbewegung habe ihren »Narrensaum«, also Leute, die sich außerhalb des liberalen Konsenses bewegen und wahlweise zu viel oder zu wenig staatliche Gewalt, zu viel oder zu wenig künstlerische Freiheit, zu viel oder zu wenig medizinische Fürsorge verlangen. Anders gesagt: Eine Gesellschaft des Spektakels dreht leicht durch, wenn man ihr die Spektakel nimmt. Eine milde Verlaufsform ist es, wenn man sich das Spektakelhafte der Welt einfach ein bisschen einbildet.
Vernünftigerweise wird man Doomscrolling nicht so sehr als persönliche Störung ansehen, sondern viel eher als einen der vielen Versuche einer Gesellschaft in der Krise, sich selbst zu verstehen oder Unverständlichem wenigstens einen Namen zu geben.
Eines der Symptome, die der lunatic fringe zeigt, eines, das nicht öffentlich und daher auch weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Erregungen auftritt, ist das »Doomscrolling« oder »Doomsurfing«. Der Begriff beschreibt den suchtähnlichen oder zwanghaften Konsum negativer oder katastrophaler Nachrichten in den sozialen Medien, der sich im Extremfall zu einer psychischen Störung auswächst.
Einen ersten Auftritt erlebte der Begriff auf Twitter wohl im Oktober 2018. Schlechte Nachrichten gab es damals genug: aus dem Iran und von den Anschlägen des »Islamischen Staats« (IS), Mineneinstürze im Kongo, in Deutschland über das »Horrorhaus« in Höxter, der Sonderbericht des Weltklimarats IPCC zur Erderwärmung, in Brasilien wird Jair Bolsonaro ins Präsidentenamt gewählt, in Druschba explodiert ein Munitionslager, weltweite Migration und brutale Maßnahmen dagegen, eine Hungerkatastrophe im Jemen, ein Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh … Es ist eigentlich nur das katastrophal Gewohnte, die gewohnten Katastrophen. Deswegen war die Bezeichnung Doomscrolling wohl auch vor allem als kritische oder satirische Beschreibung eines längst bekannten, aber sich offenbar immer weiter verbreitenden Medienverhaltens gedacht.
Einen wahren Boom erlebte der Begriff mit Beginn der Coronakrise. Nun sollte er einen dramatischen Bruch mit den Gewohnheiten bezeichnen – eine Persönlichkeitskrise als verheerende Reaktion auf die allgemeine Krise. Es schien, als stehe Doomscrolling kurz davor, in den Kanon der psychischen Erkrankungen aufgenommen zu werden. Ob es vor allem eine Reaktion auf die Isolation oder die allgemeine schlechte Stimmung war und ist oder aber ob es sich gewissermaßen um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung handelt, ein Geschehen in der Echokammer der »Infodemie«, die die Pandemie begleiten muss, wird sich erweisen.
Wer weder die Gesellschaft noch seine Klassenzugehörigkeit verändern kann, »der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang, nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen«, sagt Adorno.
In die politische Debatte gelangte das Phänomen nicht zuletzt durch einen Artikel in der Los Angeles Times im April. Mark Z. Barabak listete darin eine Reihe von Begriffen auf, die in der Coronakrise häufig verwendet wurden, darunter ventilator, community spread, asymptomatic und eben doomscrolling. Umschrieben wurde Letzteres als »an excessive amount of screen time devoted to the absorption of dystopian news«.
In der Krise rücken Begriff und Verhalten näher zueinander und ein Lexikon der Pandemie, das irgendwer demnächst schreiben wird, wird gleichermaßen beschreibenden wie auffordernden Charakter haben. Vernünftigerweise wird man Doomscrolling nicht so sehr als persönliche Störung ansehen, sondern viel eher als einen der vielen Versuche einer Gesellschaft in der Krise, sich selbst zu verstehen oder Unverständlichem wenigstens einen Namen zu geben.
Doomscrolling ließe sich zunächst einmal als eine verschärfte Form der in der bürgerlichen Kultur wohlbekannten Lust an der schlechten Nachricht und als Fortschreibung der »Katastrophenphantasie« in der Populärkultur ansehen. Die Lust an der schlechten Nachricht hat zunächst einmal sehr einfache Ursachen und Wirkungen:
a) die pure Schadenfreude, die sich in einer Gesellschaft verbreitet, die auf Konkurrenz aufgebaut ist, in der sich Gewinnen als das Andere des Verlierens verwirklicht, oder, noch tiefer, als Glaube daran, dass das, was anderen geschieht, einem selbst nicht passieren kann.
b) die »biedermeierliche« Lust an einer inneren Sicherheit, die sich durch ein rettungslos chaotisches und gefährliches Außen steigert. Je furchtbarer das Geschehen draußen, umso heimeliger der Innenraum und umso legitimer seine Begrenzung. So benötigt zum Beispiel die Retromanie, die Sehnsucht nach einer guten alten heilen Welt, die es natürlich nie gegeben hat, das katastrophische und dämonische Gegenbild.
c) die Phantasie des Strafgerichts und die Vorstellung einer »gerechten« Strafe für etwas, möglicherweise auch eine Projektion der eigenen Versagung: »Doom« hat neben der Bedeutung von Desaster und düsterem Grauen auch die Konnotation von Urteil oder von Schicksal, doomsday bezeichnet im Englischen das Jüngste Gericht. Eine Identifikation mit der Macht dessen, was Angst einflößt, erzeugt die blinde Erhabenheit negativer Transzendenz. Wenn man nur alle Spuren und Aspekte der Verdammung zusammenbringt, ergibt sich ein Ausweg in die Erlösung. Es muss bewiesen werden, dass diese Welt nicht mehr zu retten ist, damit man sich »der anderen Welt« zuwenden kann.
d) ein Management der Angst und die Strategie der negativen Zote: Die Angst, die King Kong dem anderen macht – vielleicht der Frau neben dem Mann im Kino? –, vermittelt Macht über sie. Das magische Dreieck aus Drache, Jungfrau und Ritter löst sich in unzählige Puzzleteile auf; die katastrophale Gefahr vereint das Widersprüchliche. Lieber eine in Bedrohung vereinte als im Wesen zerbrochene Welt. Es geht darum, die Angst, die sich in mir staut, medial und semantisch zu verbreiten.
e) die affektive »Entladung« und die in der Ästhetik des Katastrophenbilds verborgene Lust. Die Katastrophe bekommt Dramaturgie, Bild und Bezeichnung. Die Suche nach den dystopischen Teilen ist eine nach dem Ganzen des Bösen. Man will etwas abhaben von den Orgasmen der Welt.
f) die apokalyptische Konstruktion der Welt als Erklärung des eigenen Elends. Im Zustand der Welt spiegelt sich das eigene psychische Defizit. In einer gesunden Welt wäre Kranksein schrecklicher als in einer kranken; die trostlose Welt ist ein paradoxer Trost der unglücklichen Seele.
Wer weder die Gesellschaft noch seine Klassenzugehörigkeit verändern kann, »der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang, nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen«, sagt Adorno. Früher oder später sortieren sich die Puzzle-Teile der dystopischen Nachrichten doch wieder zur erhellenden Phantasie der Verschwörung. Vielleicht sucht man gar nicht nach schlechten Nachrichten, sondern konstruiert den oder die Schuldigen, arbeitet sich aus der Negation auf ein verwertbares Feindbild hin.
Wie ein Spieler sucht der Doomscroller womöglich nach einer Rettung, die er nie akzeptieren kann. Es handelt sich mithin um eine maskierte Form von Selbstbestrafung und Selbstzerstörung. Im Doom-Mythos (Verderben, Schicksal, Urteil, Katastrophe, Endgericht) wird aus Angst, Langeweile und Isolation das Bild des »Spektakels« zurückgewonnen. Und nur im Spektakel kann eine Gesellschaft, die ihre Kompetenzen an den Markt abgetreten hat, noch an sich selbst glauben.
Doomscrolling ist ein Krisensymptom der Mittelschicht, jenes Kleinbürgertums, das seine politische Ohnmacht und ökonomische Bedeutungslosigkeit durch moralische Überlegenheit kompensiert. Schlechte Nachrichten sind Belege der eigenen moralischen Überlegenheit, und wie von jeder Droge braucht man auch von dieser immer mehr.
Es gibt also durchaus »gute« Gründe, sich in der Krise mit schlechten Nachrichten vollzustopfen wie mit Kartoffelchips oder Seifenopern. Aber beinahe noch entlastender scheint die Vorstellung von Nachbarn, die noch viel mehr in den lunatic fringe, den Narrensaum der Krise, gezogen wurden als man selbst und die jetzt, du wirst es nicht glauben, den ganzen Tag auf einem Tablet herumdaddeln, nur um neue Horrornachrichten zu sammeln. Wie krank ist das denn!
Dann freilich wäre Doomscrolling wenn nicht ein neues kulturpessimistisches Phantasma in der Krise, dann doch eine Dramatisierung, die Hysterisierung eines Verhaltens, die unter den gegebenen Umständen (und sogar ohne Krise) »ganz normal« ist.
Beim Doomscrolling geht es auch um die ästhetische Lust am Desaster. Anders als beim Scrollen nach Informationen geht es dabei nur am Rande um den realen Gehalt. Vielmehr werden in der Doom-Ästhetik fundamentale Formen der Zerstörung genossen: die Explosion, die Flut, das »exponentielle Wachstum«, der Sturm, der Einsturz, die Leerung und das Verschwinden, die Verfinsterung und das Chaos. Auch hier kommt man um die Feststellung Adornos nicht herum, dass Menschen, die sich all die Katastrophen so angelegentlich vorstellen, sie in irgendeiner Weise auch wollen. Dies freilich erst in letzter Konsequenz; zunächst lassen sich auch hier durchaus taktische Gründe für die Kulte der Katastrophenbilder anführen:
1) ein Prinzip der Gewöhnung und Abhärtung. Vielleicht schwindet meine Angst, wenn ich mich immer wieder Simulationen und Abbildungen dessen aussetze, wovor ich Angst habe?
2) die Angstlust einer virtuellen Mutprobe. Im Aushalten des Horrors erkenne ich meine Stärke.
3) die Katastrophe als Geburtshelfer eines neuen Lebens. Durch die Katastrophe kann es vielleicht gelingen, »alles hinter sich zu lassen«. In der Katastrophenphantasie der Science-Fiction, wie sie Susan Sontag untersuchte, ist immer auch eine Fluchtphantasie verborgen. Es kann gelingen, »neu anzufangen«, wie die Überlebenden einer Zombie-Katastrophe, die neue, solidarische und fürsorgliche Gemeinschaften zu bilden pflegen.
4) der Bruch mit Alltag, Gewöhnlichkeit, Normalität, das Pathos des radikal Unerhörten.
5) die Rachephantasie, sei sie allgemein soziophober oder persönlicher Art.
6) das Bild der verbotenen Wünsche. Das Katastrophenbild, das in Wahrheit Bild des Verdrängten und Unterdrückten ist, eine symbolische, durch »sekundäre Traumarbeit« maskierte Wunscherfüllung.
7) das Überleben als Identitätsstiftung. Ein Erwachen, Erwecken und Initiieren. Die Katastrophe ist die letzte Chance, zu werden, wer man ist oder sein soll oder will.
8) die Katastrophe als Offenbarung. Nicht nur Götter, Teufel oder Welten offenbaren sich, indem sich da etwas Ungeheures auftut, sondern das Größere an sich. Das zuerst so chaotische Bild der Katastrophe verdichtet sich zum Bild des Superkörpers, und die durch die Katastrophe in alle Richtungen zerstobenen Menschen formieren sich zur Superfamilie.
9) die Katastrophe ist die Vorwegnahme des Jüngsten Gerichts (oder eines ähnlichen Endpunkts der Geschichte): Wer wird gerettet und wer nicht? Wer opfert sich heroisch und wer stirbt einen schäbigen Tod? Wer bewährt sich und wer entlarvt sich? Wer findet zusammen und wer trennt sich? Die Katastrophe ist eine Stunde der Wahrheit.
Katastrophen sind geil, weil sie zugleich sinnlich und eindeutig sind. Sie gleichen einer Rückkehr in die Kindheit, in der ein Weg zur Welt das lustvolle Kaputtmachen war.
Es ist ziemlich eindeutig: Doomscrolling bezeichnet die Verbindung der Sucht nach schlechten Nachrichten als Konstante der bürgerlichen Weltsicht mit der Katastrophenphantasie als dem Affektmanagement in der entzauberten Welt. Wo das Glück nicht zu haben ist, soll wenigstens das Unglück total sein. Den Rahmen liefern die äußere Krise und ein Mangel an verbindlicher Kommunikation. Die Schnittstellen zur Verschwörungsphantasie sind ebenso deutlich wie die zu einer Faschisierung des Weltbildes. Aber nicht alle Schnittstellen müssen auch genutzt werden.
Zugleich kann Doomscrolling aber auch eines jener Wörter sein, mit denen man sich in einer sarkastischen Neosemantik in der Dauerkrise einzurichten versteht. In der New York Times schreibt Kevin Roose, Doomscrolling sei, wie »in ein tiefes Kaninchenloch zu fallen, das randvoll mit Coronavirus-Inhalt gefüllt ist, und sich dabei so aufzuregen, dass man in einen psychischen und physischen Zustand verfällt, in dem alle Hoffnung auf eine in ruhigem tiefen Schlaf verbrachte Nacht dahin ist«. Dann ist das Wort ungefähr so tiefschürfend wie Quarantini (den Martini, den man trinkt, während man zu Hause hocken muss), Zoombombing (das Eindringen in eine Zoom-Konferenz, zu der man eigentlich gar nicht eingeladen war) oder Coronnials (die Generation, die in der Pandemiezeit gezeugt und geboren wird). Eine verbale Gegenbewegung gegen die erdrückende Sprache der offiziellen Pandemiemaßnahmen wie Abstandsgebot, Maskenpflicht, Nachverfolgung entsteht da vielleicht und stiftet Alltag und Unfrieden unter der Medienglocke.
Die Krise, sagt man, macht hier und da sichtbar, was in der Normalität verborgen ist. In den Worten, Bildern und medialen Praktiken kommt das Gewöhnliche in verschärfter Form hervor und wird auf oft paradoxe Weise wiederum zum Gewöhnlichen. Wörter entstehen wie Blasen auf seltsamem Gebräu, und sie beschreiben vor allem die Hitze im Kessel. Doomscrolling zum Beispiel könnte ein besorgniserregendes subjektives Verhalten sein, eine normale »bürgerliche« Verhaltensweise, der man in der semantischen Flaute der langen Krise eine spektakuläre Aufwertung angedeihen lässt. Es könnte aber auch einfach eine Projektion der eigenen Unsicherheit sein. Der Schlaf unserer Vernunft gebiert seine Ungeheuerchen.


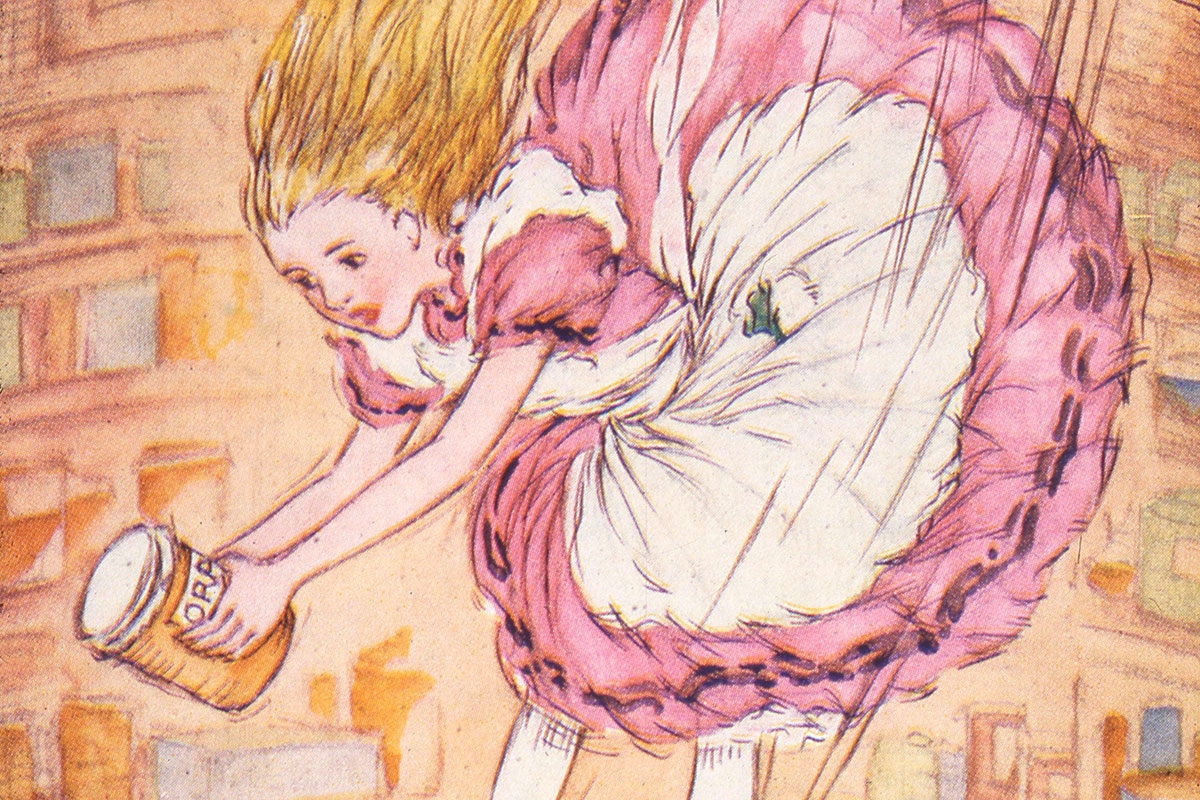



 Die Katzen des Louvre
Die Katzen des Louvre
