»Vergessen kann auch produktiv sein«
Ihr habt mit der Band Ornament & Verbrechen 1983 in Ost-berlin angefangen, Musik zu machen. Wie kam es dazu?
Ronald: Ich habe in einer Band gespielt, die hieß Rosa Extra, nach der Marke einer Damenbinde. Robert spielte in einer Band, die nach einem Jules-Verne-Roman benannt war, »Fünf Wochen im Ballon«. Wir haben unabhängig voneinander angefangen, Musik zu machen. Irgendwann hatten wir die Idee, dass wir etwas zusammen machen – als Brüder. Robert lebte damals in Marzahn und dort fanden auch die ersten Proben statt. Die ersten Instrumente waren eine Fit-Verpackung, das Reinigungsmittel aus der DDR, gefüllt mit Legosteinen, das war unser Schlagzeug, und ein Casio-Synthesizer. So haben wir angefangen – und fanden dann Gefallen daran.
Robert: Wir hatten früh angefangen, John Peel zu hören. Als das 1977 losging mit Punk und New Wave, hingen wir ständig am Radio und waren fasziniert von Throbbing Gristle und Cabaret Voltaire, die auch nochmal einen anderen Ansatz hatten als Punk, weil es auch eher um Geräusche ging. Das war der Anstoß für uns. Wenn die ohne musikalisches Wissen eine Band gründen können, dann machen wir das auch.
Die Einflüsse kamen aus Großbritannien. Gab es auch Musik, auf die ihr keine Lust mehr hattet, von der ihr euch abgrenzen wolltet?
Robert: Den ganzen aufgeblasenen Progrock wollten wir nicht mehr hören.
Ronald: Es war schon eine Anti-Rock-Bewegung. Wir verwendeten nicht mehr die Instrumente einer klassischen Rockgruppe, sondern benutzten Salatschüsseln oder bauten irgendeinen Synthesizer um. Diese ganze Male-Rock-Attitüde haben wir vermieden, das richtete sich nicht nur gegen den Mainstream-Rock oder Progrock, sondern auch gegen bestimmte Erscheinungen im Punkrock selbst.
Ihr wolltet auch einfach erstmal loslegen?
Ronald: Wir hatten ein Interesse an neuen Klängen. Wir haben mit Kurzwellenfrequenzen gearbeitet, wir haben versucht, einen anderen Klang zu erzeugen – etwas, das nicht schon da war. Wir wollten eine neue Klangwelt erfinden. Dafür haben wir dann auch klassische Instrumente benutzt. Das erste Instrument, das ich mir gekauft habe, war ein Trowa-Becken, das hört man dann auch auf den ersten Aufnahmen von Ornament & Verbrechen. Wir haben versucht, etwas anderes zu machen, auch als Selbstentertainment, um uns selbst besser unterhalten zu fühlen.
Von dem, was es gab, fühltet ihr euch nicht mehr unterhalten. Da war also eine große Sehnsucht nach etwas Neuem da?
Robert: Die Musikstile änderten sich von Jahr zu Jahr. Nach Punkrock kam New Wave, dann HipHop, House und Acid, das ging Anfang der achtziger Jahre los. Man hatte ständig neue Ideengeber. Plötzlich wurde beispielsweise mit Samples gearbeitet, das gab es vorher nicht. Es kamen neue Impulse, die man mit bescheideneren Mitteln auch selbst aufnehmen wollte.
Ronald: Deswegen haben wir das Projekt Ornament & Verbrechen auch früh für andere Leute geöffnet. Robert und ich haben zwar angefangen, wir haben dann aber recht schnell andere Leute eingeladen. So war Ornament & Verbrechen nie eine Band mit einem Stil, sondern eine Plattform, um Sachen miteinander zu machen. Der Stil der Band konnte sich radikal verändern durch einen Neuzugang.
Ihr habt also mit einem kollaborativen Ansatz gearbeitet, wie man heute sagen würde. Ihr habt euch auch immer für andere Künste interessiert, Literatur, Film, Performance, bildende Kunst, Theater. Wie kam es dazu?
Ronald: Als wir in Ostberlin anfingen, Musik zu machen, war das ganz natürlich. Beim ersten Konzert von uns wurde vom Tonband von Wilhelm Reich die »Rede an den kleinen Mann« abgespielt, dann hat der Dichter Bert Papenfuß gelesen und wir haben anschließend Coverversionen von Human League gespielt – wofür wir eine Mundharmonika durch ein Echogerät laufen ließen. Das kam uns aber nicht als große kulturelle Tat vor, sondern war ganz normal. Wir wollten auch nicht gezielt mit anderen Kunstrichtungen in Berührung kommen, das ergab sich einfach aus den Zusammenhängen und Freundschaften. Bert Papenfuß konnte beispielsweise sehr gut Leute zusammenbringen. Das war manchmal auch sehr explosiv, weil sich die Leute im Ost-Underground keineswegs alle einig waren.
Robert: Ich bin ja zweieinhalb Jahre jünger als Ronald, bin nochmal in einer anderen Szene groß geworden. Wir saßen beispielsweise im Tutti Frutti und die Älteren in der Tute am Alexanderplatz, die beiden Lokale waren zwar nur 800 Meter entfernt, trennten aber Welten.
Was bedeutete für euch Underground oder Subkultur? Das hängt ja auch mit der Idee von Subversion, der unkontrollierten und unkontrollierbaren Produktion zusammen.
Ronald: Die Subversion wurde uns eigentlich aufgezwungen. Wir wollten nur unsere Sachen machen. Das war ein Unterschied zu einer vorigen Generation von Dissidenten, die eine andere DDR oder einen anderen Weg angestrebt haben. Wir haben einfach unsere Kassetten gemacht und die weitergegeben – das war aber vom Gesetz verboten. So kamen wir in Konflikt mit dem Staat und der Staatssicherheit. Die hätten uns einfach in Ruhe lassen sollen.
Robert: Wir haben nicht die Grenzen erproben wollen, sondern diese Grenzen waren einfach sofort da.
Ronald: Dann kam die Stasi bei uns ins Haus und fragte die Nachbarn, ob es einen Proberaum gäbe. Die älteren Frauen aus dem Haus erzählten uns dann, dass sich zwei Herren nach uns erkundigt hatten. Es ist im Grunde bizarr, dass wir aus ästhetischen Gründen in einen politischen Konflikt hineingeraten sind.
Die späte DDR hatte einen aufgeblähten Sicherheitsapparat, der jede nicht voraussehbare Bewegung gleich für staatsgefährdend gehalten hat.
Robert: Mit Glasnost veränderte sich etwas. Der Staat wurde etwas altersmilde, je näher er seinem Ende kam.
Ronald: Ab Mitte der achtziger Jahre war die Repression keinesfalls so brutal wie noch Anfang der achtziger Jahre. Viele Leute konnten ja auch in den Westen ausreisen. Auch im Radio wurden Sachen gespielt, die eigentlich nach dem Gesetz nicht hätten produziert werden dürfen, weil die von Bands gemacht wurden, die einfach ohne Erlaubnis ihre Kassetten machten, die auch keine Auftrittserlaubnis hatten. Das war eine paradoxe Situation: Es war verboten, wurde aber gespielt.
Zu welchen anderen Bands und Gruppen hattet ihr Kontakt oder habt ihr auch Kontakt gesucht?
Ronald: Es gab viel Kontakt und auch Solidarität unter den Bands. Wir kannten beispielsweise die ungarische Band Die rasenden Leichenbeschauer, die von einem Astrophysiker gegründet wurde. Die trafen wir 1984 in einer Wohnung in Ostberlin, schauten und hörten uns Sachen von denen an, die durften auch schon im Westen spielen. Und wir haben die Super-8-Filme gezeigt, die wir gemacht hatten. Es war beispielsweise auch üblich, viele Sessions zu machen, nächtliche Sessions. Wie die Jazzmusiker im New York der fünfziger Jahre traf man sich und spielte gemeinsam bis in den frühen Morgen.
Habt ihr den Eindruck, dass dieser DDR-Underground inzwischen vergessen ist?
Robert: Schön wär’s. Ich würde gerne mehr in die Zukunft schauen. Vergessen ist das nicht, obwohl das Vergessen manchmal für eine musikalische Entwicklung auch produktiv sein kann. Es gab ja vor zwei Jahren die Ausstellung »Geniale Dilletanten« im Haus der Kunst in München über die Subkultur der achtziger Jahre in Deutschland, da war Ornament & Verbrechen auch vertreten – neben Einstürzende Neubauten, Die Tödliche Doris, Freiwillige Selbstkontrolle, Palais Schaumburg, Deutsch-Amerikanische Freundschaft und Der Plan. Für die Ausstellung haben wir auch unsere Instrumente nachgebaut, unter anderem die Fit-Schachtel mit den Legosteinen. Wir hatten auch eine Schublade, die war mit Ziegenfell bespannt, die haben wir auch nachgebaut, ebenso ein Saxophon aus einem Mopedauspuff.
Ronald: Es gibt die Gefahr, nur auf die Vergangenheit zu schauen. Das muss man sich auch überlegen, ob man überhaupt darüber sprechen möchte. Wir machen das. Ornament & Verbrechen hatte sich ja für einen bestimmten Anlass in einer bestimmten Situation gegründet. Dann gab es auch immer wieder längere Pausen in der Geschichte der Band. Als wir beispielsweise 2003 von der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin für die Ausstellung »Lieber zu viel als zu wenig. Kunst, Musik, Aktionen zwischen Hedonismus und Nihilismus (1976–1985)« gefragt wurden, ob wir wieder etwas machen wollten, war das auch eine neue Situation. Wir haben kein Repertoire. Und weil wir immer wieder etwas neu erfinden müssen, ist es im Grunde wie früher auch. Ob es eher in Richtung Jazz geht oder Acid, entscheidet sich bei dem Anlass selbst.
Was hat sich denn für euch 1989/90 mit dem Ende der DDR verändert? Hat das die Szene auseinandergerissen oder eher produktiv befreit?
Robert: Teilweise zerstoben die alten Freundschaften, was aber auch nicht schlecht war, weil es in der DDR ja zu einer Art Notgemeinschaft kam, man war auch mit Leuten zusammen, mit denen man nicht so viel anfangen konnte. Die engen Freundschaften, wie beispielsweise mit Bert Papenfuß, haben sich erhalten. Und Carsten Nicolai, bekannt als Alva Noto, haben wir dann beispielsweise nach der Wende erst kennengelernt. Es hat sich eher herauskristallisiert, mit wem man wirklich zusammenarbeiten möchte.
Ronald: Der Mauerfall war für uns eigentlich ein Glücksfall. Robert war schon im Westen und ich wusste nicht, wann ich ihn wiedersehen würde, außerdem arbeiteten wir schon mit Leuten aus Westberlin zusammen, die aus dem Umfeld der Galerie Endart kamen, Bands wie Knochen=Girl zum Beispiel. Wir haben auch schnell einen Probenraum in Westberlin gefunden und konnten loslegen. Das war eine irre Zeit. Es gab diese ganzen Räume, die zur Verfügung standen. Die Technoszene profitierte auch davon, vom Ufo über den Tresor bis zum WMF. Das war sehr spannend, auch sehr befreiend. Wir haben weiter unsere Underground-Strategien gepflegt, haben eine Platte herausgebracht, die hieß »Super Deluxe Transistor Radio«, die haben wir verschenkt. Erst Mitte der neunziger Jahre haben wir überhaupt angefangen, uns für Labels zu interessieren, auf denen wir veröffentlichen konnten. Es gab also einen kleinen Delay, eine Verzögerung.
Ihr habt dann Mitte der neunziger Jahre erstmal mit Einzelprojekten weitergemacht und Ornament & Verbrechen pausierte. Wann ging es dann weiter?
Robert: Es gab ein paar verstreute Konzerte über die Jahre. 2012 wurden wir für die Ausstellung »Archipel« von Arno Brandlhuber im Neuen Berliner Kunstverein eingeladen, einen Live-Soundtrack zu machen. Wir haben ein komplett neues Set gespielt und sind seitdem auch wieder aktiver.
Ronald: Wir spielen jetzt in Städten wie Moskau, Rom, Cottbus, aber auch Berlin. (lacht)
Ihr tretet häufiger in Museen auf, im Rahmen von Ausstellungen, im Theater. Sind das neue Räume für euch?
Ronald: Das würde ich so nicht sagen. Wir haben beispielsweise 1988 am Deutschen Theater gearbeitet, da inszenierte Thomas Langhoff »Die Geisel« von Brendan Behan – und wir haben die Musik gemacht. Und jetzt sind wir wieder am Deutschen Theater und machen die Musik für Bertolt Brechts »Untergang des Egoisten Johann Fatzer« in der Regie von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner. Brecht war uns eigentlich eher fremd, ist uns aber durch die Arbeit und die Lektüre der Texte jetzt näher gekommen. Das fühlt sich nicht so unterschiedlich an – 1988 und 2017. Für unsere Arbeit hat sich nichts verändert, auch wenn das Theater inzwischen etwas schicker aussieht.
Robert: Wir haben nie die Arbeitsmethoden geändert. Es ist immer noch die Art zu komponieren, die wir damals entwickelt haben. Auch bei To Rococo Rot war es ähnlich, es gibt ein gleichbleibendes Interesse an Klang und an einer Struktur, die man sich baut.
Ronald: Was aber geblieben ist, ist unser Interesse, mit anderen Menschen zu musizieren, das zu erleben. Zu schauen, was passiert – wie bei einer chemischen Reaktion. Das macht Ornament & Verbrechen auch aus. Wir verfolgen auch aufmerksam, was gegenwärtig sich entwickelt. Eine gewisse Zeitgenossenschaft gehört natürlich zu Popmusik dazu, das hat mich auch immer ein wenig versöhnt mit dem Zeitalter, in dem ich lebe.
Was bedeutet Popmusik für euch? Welchen Begriff des Populären habt ihr vor Augen?
Ronald: Es gibt Popmusik, die sehr schräg sein kann, sehr avantgardistisch. Es gibt Popmusik, die weit weg ist von üblichen Hörgewohnheiten. Für mich bedeutet Popmusik, dass man Leute nicht dadurch ausschließt, dass sie eine bestimmte Kennerschaft benötigen, also wenn sie Musik nicht erleben können, weil ihnen Voraussetzungen fehlen. Popmusik ist nicht ein bestimmter Stil, das kann eben auch ein 30minütiges Rauschen eines Synthesizers sein, sondern eher ein demokratisches Prinzip.
Ihr tretet im April bei »Free! Music« im Haus der Kulturen der Welt in Berlin auf. Was bedeutet das für euch, Freiheit der Musik oder freie Musik?
Robert: Zuerst natürlich, dass wir nicht wissen, was wir an dem Abend machen werden. Wir wollen uns beeinflussen lassen von den Dingen, die bei dem Festival sonst noch passieren, wir nehmen das als Material. Ich besorge mir jetzt noch einen Synthesizer, der eigentlich ein wissenschaftliches Gerät für Hörtests ist, das würde ich gerne einsetzen. Aber mal schauen.
Ronald: Freiheit der Musik heißt auch, nicht den eigenen Limitierungen zu erliegen, sondern sich selbst zu provozieren, sich selbst zu unterhalten.
Robert: Und es ist natürlich auch eine politische Frage. Auf dem Festival spielt ein ägyptisches Kollektiv, für die bedeutet die Freiheit der Musik natürlich ganz praktisch etwas – wie für uns in den achtziger Jahren. Wir erleben oft, dass junge Leute heute sagen, sie wüssten gar nicht mehr, wogegen sie sein sollen. Aber wenn dann eine Nazidemo ist, sind sie zu beschäftigt, um dagegen etwas zu machen. Es gibt viele Dinge, gegen die man etwas tun kann.
Free! Music. Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Mit Baloji, Ensemble Musikfabrik, Egyptian Females Experimental Music Session, El Ombligo, Patrick Frank, Johannes Kreidler, Lautari, Louis Moholo-Moholo, Conlon Nancarrows Player Piano, Ornament & Verbrechen und anderen. 6. bis 9. April




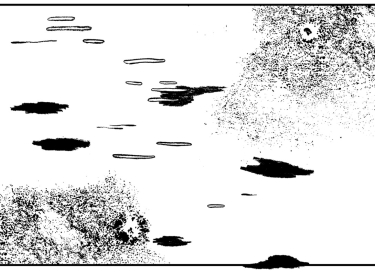
 »Birkenschwester«: Rückwärts zurück
»Birkenschwester«: Rückwärts zurück