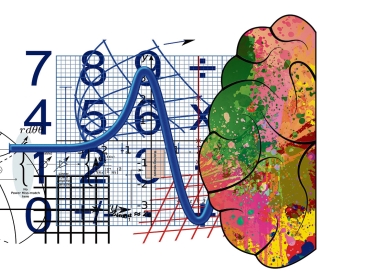Ums sauberste Trikot
Am Sonntag nachmittag ging die 85. Tour de France auf den Pariser Champs-ƒlysées zu Ende. Von den 189 gestarteten Radsportprofis aus insgesamt 21 Teams erreichte nur gut die Hälfte das Ziel.
Es gab auf der von den Negativschlagzeilen begleiteten Tour auch sportliche Höhepunkte. Zuerst, als der Tour-Sieger Marco Pantani den Schwächeanfall des Favoriten Jan Ullrich und schließlich Zweitplacierten ausnutzen konnte und sich ein ausreichendes Zeitpolster auf der Fahrt hinauf zu Les Deux Alpes für die restlichen Kilometer verschaffte. Und am darauffolgenden Tag, als Ullrich zwar erfolglos, aber beeindruckend versuchte, Pantani das Gelbe Trikot des Spitzenreiters wieder abzunehmen.
Am Ende dieser 16. Etappe von Vizille nach Albertville siegte Ullrich mit Reifenstärke vor Pantani, alle anderen Konkurrenten hatten den Anschluß verpaßt. Wie bei jeder Tour gab es am Ende Sieger und Besiegte. Die vorher feststehenden Prämien, darunter rund 660 000 Mark für den Gesamtsieger Pantani, wurden ausgezahlt und innerhalb der Teams aufgeteilt. Und im nächsten Jahr wird man sich wieder in Frankreich zur Tour treffen. Wird man sich? Die Tour zeichnete sich bislang durch ein ausbalanciertes Verhältnis verschiedener Interessengruppen aus. An erster Stelle ist hier die Société du Tour de France zu nennen, die Organisatorin der größten Radsportveranstaltung der Welt. Eng verbunden ist die Société vor allem mit der in Frankreich täglich erscheinenden Sportzeitung L'ƒquipe sowie dem Boulevardblatt Le Parisien. Damit ist auch die zweite große Gruppe benannt, die erst dafür sorgte, daß die Tour zum Spektakel werden kann: die Medien.
Ungefähr 1 800 JournalistInnen begleiteten die Tour. In Deutschland übertrugen Eurosport und die ARD täglich mehrere Stunden die einzelnen Etappen. Das Erste stellte während der dreiwöchigen Tour sogar sein Programmschema um und brachte jeweils im Anschluß an die Tagesschau vor dem regulären Abendprogramm eine viertelstündige Sondersendung. Da die ARD gleichzeitig Co-Sponsor des Team Deutsche Telekom ist, ist man bei der dritten, ebenfalls schwergewichtigen Interessengruppe: den Sponsoren. Mehr als die Hälfte des jährlich benötigten Etats wird von Unternehmen wie Coca-Cola, Crédit Lyonnais oder Festina bereitgestellt.
Sie erwerben mit ihren Zahlungen das Recht, Werbung am Mann, an der Bande, bei der Zeitnahme oder bei jeder anderen Gelegenheit zu machen. Die Veranstaltungsorte tragen zwar auch zur Tour-Finanzierung bei, es ist schließlich nichts umsonst, spielen aber im großen und ganzen eher eine untergeordnete Rolle. Ganz im Gegenteil zur Bedeutung der Sportler, ihren Trainern, Ärzten und Betreuern und der des Internationalen Radsportverbands (UCI). Es handelt sich in erster Linie immer noch um eine Radsportveranstaltung. Der den einzelnen Sportler umgebende Stab hat dafür zu sorgen, daß Blessuren behandelt und Defekte schnell behoben werden, der Radler zur rechten Zeit in Form ist und sich ansonsten den Weisungen der Teamleitung unterwirft.
Die UCI sonnt sich in erster Linie in dem Glanz, den die Tour de France ausstrahlt. Darüber hinaus stellt sie eine Liste der verbotenen Dopingsubstanzen auf, ohne für die entsprechenden Kontrollmechanismen zu sorgen. Für sie war der Zusammenhang von Doping und Radsport lediglich hypothetischer Natur, und wenn einer wie Dschamulidin Abduschaparow sich mehrfach mit Dopingsubstanzen im Körper erwischen ließ, dann handelte es sich eben um ein schwarzes Schaf. Doch bei der diesjährigen Tour de France mischte sich in dieses Beziehungsgeflecht eine neue Mitspielerin ein, die weder eingeladen war, noch sich an die überlieferten Spielregeln hielt. "Diese Frau", wie sie der Telekom-Fahrer Erik Zabel despektierlich nannte, heißt Marie-George Buffet, ist französische Sportministerin und gilt entweder als Spielverderberin oder aber als aufrechte Kämpferin für einen sauberen Sport - je nach Sichtweise.
Nach französischem Recht sind Abgabe und Verschreibung von sowie Handel mit Dopingmitteln strafbar. Buffet ging von der Vermutung aus, daß bei der Tour gedopt werde. Die Verhaftung von Willy Voet, dem Masseur des Festina-Teams, der bereits vor Tour-Beginn mit einem Kofferraum voller straftatrelevanter Substanzen dem französischen Zoll auffiel, schien die ministerielle Vermutung zu bestätigen.
Was folgte, waren konsequente Ermittlungen der französischen Polizei und Justiz gegen Fahrer und Betreuer verschiedener an der Tour beteiligten Teams. Unter dem Druck der Ermittler kam es zu Geständnissen, so beispielsweise von Armin Meier und Laurent Brochard. Doch ließen es Buffet und ihr Kollege im Innenministerium, Jean-Pierre Chevènement, bei diesen ersten Erfolgen nicht bewenden. Es wurden weitere Razzien und Verhaftungen vorgenommen. Die französischen PolitikerInnen hatten sich vorgenommen "das Böse auszurotten", wie es ihr Staatspräsident Jacques Chirac in recht markigen Worten vorgab.
Ob sie dabei prozeßverwertbare Tatbestände ermitteln konnten, läßt sich aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist es ihnen gelungen, für ein unvergeßliches Tour-Erlebnis zu sorgen.
Das völlig aus dem Gleichgewicht gekommene Tour-Gefüge war kurz davor zusammenzubrechen. Die 85. Tour de France stand mehr als einmal vor einem Abbruch. Die bisher so gut geschmierte Maschinerie kam durch das polizeiliche Eingreifen ins Stocken. Erst als an ein weiteres Durchwurschteln nicht mehr zu denken war, reagierte die Tour-Leitung mit Jean-Marie Leblanc an ihrer Spitze und schloß das komplette Festina-Team von der weiteren Teilnahme aus.
Anschließend verabschiedete sich Leblanc aus der Reihe der handelnden Personen und sah folgerichtig dem weiteren Treiben aus dem jeweils an der Spitze des Feldes fahrenden Wagen der Tour-Leitung zu. Der UCI-Präsident Hein Verbruggen mochte gar nicht erst hinsehen. Er ließ sich nur kurz bei der Tour blicken, um dann seinen lange vorher geplanten Jahresurlaub zu nehmen. Die beteiligten Teams gingen unterschiedlich mit der neuen Situation um. Vor allem die von den Razzien betroffenen Rennställe zogen teilweise auf Druck der Sponsoren ihre Fahrer zurück. Auf diese Art und Weise reduzierte sich das Teilnehmerfeld um ein Drittel. Daneben gab es dann allerdings auch Teams wie das der Deutschen Telekom. Da in dieser Mannschaft quasi per definitionem nicht gedopt wird, gab es auch keine Veranlassung zu einem Rückzug.
Von ihren Funktionären im Stich gelassen, versuchten zumindest die Fahrer, auf die weitere Entwicklung Einfluß zu nehmen. Sie inszenierten zwei teilweise im Sitzen ausgetragene Streiks. Ihr Protest richtete sich gegen die Behandlung durch die Medien und die Polizei. Die MedienvertreterInnen sollten sich doch bitte ausschließlich um die sportlichen Belange der Tour kümmern, Doping habe schließlich nichts mit Sport zu tun, und die Polizei solle sie bei ihren Vernehmungen wenigstens menschenwürdig behandeln.
Die zweite Forderung ist vollauf berechtigt, jedoch schwer umzusetzen, da Menschenwürde und polizeiliches Eingreifen grundsätzlich schwer in Einklang zu bringen sind. Doch irren die Fahrer hinsichtlich ihrer ersten Forderung. Die Medien berichten über die sportlichen Leistungen. Beide Seiten sind aufeinander angewiesen, auch finanziell. Doch muß es auch möglich sein, über das Zustandekommen dieser Leistung zu berichten. Und anscheinend gehört die Einnahme leistungsfördernder Mittel zum Profiradsport dazu.
Die Sportler könnten allerdings versuchen, die unübersichtliche Situation für ihre Zwecke auszunutzen. Sie wissen selbst am besten, was ihre Körper brauchen, um die allseits geforderten Leistungen zu erbringen. Dementsprechend könnten sie die Freigabe verschiedener, derzeit verbotener Substanzen fordern. Darunter würde der Wettbewerb nicht leiden, und darum geht es in erster Linie.
Doch wie ließen sich die selbsternannten KämpferInnen für einen sauberen Sport von dieser anderen Sichtweise überzeugen? Wahrscheinlich gar nicht, aber vielleicht reicht es ja, ihnen die komplette 15. Etappe von Grenoble nach Les Deux Alpes als Videokassette zu schenken. Diese Fahrt über die französischen Alpen war für die Sportler alles andere als gesund und sauber. Denn vor den frierenden und vom Dauerregen durchnäßten Zuschauern fuhr ein sichtlich leidender Ullrich zum letzten Mal bei dieser Tour das Gelbe Trikot ins Ziel - es war völlig verdreckt.