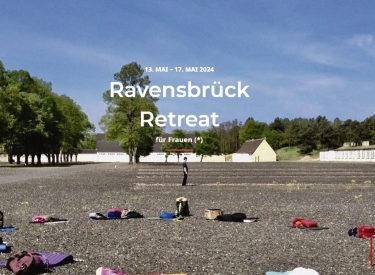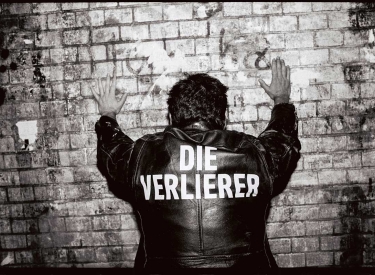Das Fremde daheim
Warum eigentlich repräsentiert der Karpfen beim japanischen Jungenfest Stärke und Widerstandskraft? Dieser großmäulige und plusterbackige Fisch, der hierzulande doch eher als Herbstopfer in Bierteig dargebracht und mit Kartoffelsalat in der Messe der heiligen Völlerei verzehrt wird, dekoriert als Plastikimitation den altarähnlich hergerichteten Aufbau, mit dem des Jungen Männlichkeit schon sehr früh gepriesen wird.
Der Rest ist bekannt. Samurai-Utensilien symbolisieren bekannte männlich kodierte Eigenschaften: Stärke, Zähigkeit, Ehre, Kampfbereitschaft. Demgegenüber sieht das Arrangement auf dem Altar des Mädchens natürlich anders aus. In edle Kleider gewandete Püppchen werden von Kaiser und Kaiserin - ebenfalls als Puppenmodelle - beaufsichtigt, Gerätschaften des Alltags verweisen auf die Arbeit, die der Frau einst auferlegt sein wird, ein blühender Pfirsichbaum aus Stoff und Plastik steht für als weiblich wahrgenomme Wesenszüge: Mildheit und Zärtlichkeit.
"Sie und Er", die Ausstellung des Rautenstrauch-Joest-Museums für Völkerkunde in der Kölner Kunsthalle, ist so etwas wie der Versuch einer Illustrierung der Gender-Debatte. Was macht Mädchen zu Mädchen und Jungen zu Jungen? Was ist eine Frau, was ein Mann? Geschlecht als soziales Konstrukt - Natur und Biologie kontra Kultur: Der Junge wird dazu gebracht, sich mit der Samurai-Maske zu identifizieren, das Mädchen beginnt notgedrungen, den Duft der Pfirsichblüten als angemessenen Ausdruck für Geisteshaltung und Körperlichkeit zu akzeptieren. Wer in den vergangenen Jahren ein wenig aufgepaßte, hat dazu keine Fragen. Aber - das immerhin muß man einer Rezeption der Ausstellung voranstellen - "Sie und Er" ist eine Publikumsschau und kein gewichtiger Beitrag zur Debatte. Faßt zusammen, statt zu forcieren.
Nun hätten sich wahrscheinlich bis auf die rätselhaften Karpfen Exponate mit ganz ähnlicher Symbolkraft wie jene in den japanischen Inszenierungen in jedem herkömmlichen deutschen Spielwarenladen finden lassen. Aber es ist vielleicht das grundsätzliche Problem der Ethnologie, daß sie das Fremde in den Mittelpunkt ihres Interesses stellt. Der kühle Blick, der sezierend Bräuche und Gewohnheiten prüft, wendet sich stets nach außen und weiß trefflich die Angelegenheiten anderer zu erklären. Für die Dinge des Inneren gibt es schließlich andere Autoritäten - Heitmeyer, Kanther und Kriminalitätsforschung etwa.
Der Weg durch die Ausstellung führt durch zwölf sehr unterschiedliche Stationen, Stichworte sind Androgynität, Paarbilder, Erziehung der Geschlechter, Raum als gesellschaftliche Konstruktion, Arbeitsteilung, Geschlecht und Macht oder Geschlecht und Religion. Einigen Installationen stehen zahlreiche Fotos, mehrere medizinische Modelle und vor allem einzelne Exponate aus dem täglichen Gebrauch gegenüber. Auch zeitgemäßere Formen der Präsentation kommen zur Anwendung.
Ein schönes und kurzweiliges Spiel auf den Bildschirmen zweier Computer lädt auf der oberen von zwei Etagen der Kunsthalle zu Kurzweil und Unterhaltung. Mit der Mouse lassen sich überall auf einer Karte, die die ganze Erde darstellt, Punkte anklicken, hinter denen sich zum Thema "Geschlechtersegregation im Raum" hübsche bunte Grafiken verbergen, die, farblich abgesetzt, die traditionell gemeinsamen und getrennten Lebensräume von weiblichen und männlichen Familienangehörigen in Haus und Hof skizzieren. Überall auf der Erde? Fast überall. Die Kapitel heißen "Amerika", "Asien und arabischer Raum", "Ozeanien", "Indonesien" und "Afrika".
Ach, Europa. Gerade weil "Sie und Er" eine Publikumsschau ist, muß dieser Verzicht auf europäische Standards als mindestens desaströse (In-)Konsequenz wahrgenommen werden. Mit sowas hat das aufgeschlossene und vermeintlich säkularisierte Europa nix zu tun - so wird es das Publikum nämlich verstehen. Die Aussparung Europas auf diesem Wege kommt der Aussperrung der eigenen, der europäischen Erfahrungen gleich. Der viel zu totale Bezug aufs Fremde legt eben nicht den Vergleich mit dem Eigenen nah, sondern verstellt den Blick darauf.
Die seltsame Erweiterung des Begriffs des Fremden in der Ausstellungskonzeption findet sich in der Art und Weise, wie Europa dann doch auf den beiden Etagen verarbeitet wurde. Während die allermeisten Exponate aus anderen Kontinenten ethisch äußerst penibel zugeordnet werden (etwa "Navajo, Nordamerika" oder "Lobi, Westafrika"; Ausnahme Japan, hier wird lediglich der Nationalstaat kenntlich gemacht) und auf Traditionen verwiesen wird, die zum allergrößten Teil bis heute fortbestehen, findet Europa fast nur in der Vergangenheit statt.
Abgesehen davon, daß Europa in der Definition ethnischer und rassistischer Grenzen oder Unterschiede seine eigene nicht ganz uninteressante Geschichte hat, finden sich Exponate unseres Kontinents, abseits einiger Arbeiten der Kunst dieses Jahrhundertts, nur eingebettet in die Fremdheit lange vergangener Epochen. Zu allerlei faszinierendem Folterwerkzeug aus der Zeit der Inquisition wird der Hexenhammer gelegt, und ein Kärtchen kommentiert: "...diesem Werk ist bedenkenlos zu bescheinigen, das frauenfeindlichste der Welt zu sein." Daß diese katholische Haltung bis heute ihre Fortsetzung in einem der modernen Gesellschaft angepaßten Rahmen findet, wird nicht einmal am Rande bemerkt. Und damit negiert, daß Geschlechtersegregation und ihre Urgründe in Europa eine Gegenwart haben, die sich am deutlichsten in den Strukturen der katholischen Kirche erhalten hat, aber auch an anderen Orten perpetuiert wird.
Frauen also: Der Begriff korrespondiert mit Nahrung oder Stoffen. Und Männer: Hier haben wir Waffen, Metall, Holz. Das ist die Tradition, die über westafrikanische, indonesische oder ozeanische Exponate belegt wird, welche Zuschreibungen und kulturelle Gebote auch immer dafür verantwortlich sind. Wer sich ab und zu Zeit nimmt, die Fernsehnachrichten zu schauen, hat einen Eindruck davon, daß die Moderne zum Beispiel in vielen Teilen Westafrikas wenig Gelegenheit hatte, dort Fuß zu fassen. Man spricht ganz allgemein von Armut, ein paternalistischerer Begriff ist Unterentwicklung. Viele Menschen leben dort wie ihre Vorfahren, oder jedenfalls ganz ähnlich. Es wird so durch die elliptische Konzeption der Ausstellung wenigsten andeutungsweise ein Bild von Primitivität des Anderen vermittelt, das nur entstehen kann, weil ein modernes Europa, genauer: der Norden, so wenig präsent ist. Dann die dort unten leben immer noch so wie im Mittelalter. Europa heute, das ist als Ausdruck der Ausstellung lediglich der "Nachbau eines Bordellzimmers in einem Eroscenter in Frankfurt" und "Vitrine mit den Werkzeugen einer Domina". Das Zimmer ist ausgestattet mit allerlei knappem und buntem Schnickschnack, das frau ziemich schnell ausziehen kann. Nur: Wie sehen denn heute die Puffzimmer in Accra, Djakarta oder Port Moresby aus? Diese Zeichen der Moderne gibt es schließlich überall auf der Welt.
"Sie und Er" ist eine Ausstellung zum Gucken. Die Gegenüberstellungen von als weiblich oder männlich wahrgenommenen Umgebungen, für Mädchen und Jungen konzipiertes Zeug zum Spielen oder Arbeiten oder symbolhaft runden oder eckigen Formen in alltäglichen Instrumenten ist immer amüsant, wirkt natürlich auch erhellend. Doch die Debatte, die zuerst eine nordamerikanische war und dann allmählich auch eine europäische wird, hätte eine etwas introspektivere Illustration durchaus vertragen. So fortgeschritten und kompliziert sind weder unsere Gesellschaften noch die Individuen, die sich in ihnen organisieren, daß nicht wirklich naheliegendere Belege für die These zu finden gewesen wären, daß Geschlecht etwas Gemachtes ist. Und warum der Karpfen bei den Japanern und Japanerinnen für Stärke und Widerstandskraft steht, weiß man auch nicht nach dem Besuch der Ausstellung. Aber vielleicht ist das ja auch nur so eine Zuschreibung.
Bis zum 8. März 1998, Josef-Haubrich-Kunsthalle, Köln


 Freiheit im Fokus
Freiheit im Fokus