Verantwortungslose Fröhlichkeit
Nachdem Richard Samet Friedman 1944 in Chicago in eine jüdische Familie geboren worden war, zog er mit dieser nach Texas, als er ein Jahr alt war. Seine Eltern waren beide Kinder russischer Einwanderer. Er wuchs auf der Echo Hill Ranch auf, die seine Eltern zu einem Ferienlager für Kinder und einem Treffpunkt für die Juden in Texas machten. 1966 machte er an der University of Texas einen Abschluss mit dem Hauptfach Psychologie und ging zum Peace Corps auf Borneo, wo er »Kindern das Frisbee-Spielen und einige Hank-Williams-Songs« beibrachte. 1968 ging er als Songwriter nach Nashville, Tennessee. 1973 war er dann mit seiner Band The Texas Jewboys und der Platte »Sold American« am Start – auf dem Cover prangte der Name Kinky Friedman. Den Spitznamen hatte man ihm wegen seinen lockigen Haaren verpasst.
Beim ersten Treffen der beiden sang Bob Dylan Friedman zu Ehren »Ride ’em Jewboy«, was diesen aber nicht sonderlich beeindruckte: »Erwartest du jetzt etwa, dass ich irgendeinen deiner Songs spiele? Ich kann diese Scheiße nicht singen.«
»Sold American« schaffte es sogar in die Country-Charts, die Musiker spielten im Grand Ole Opry, der bedeutendsten Radiosendung für Country-Musik in Nashville. Bald darauf traten Kinky Friedman and The Texas Jewboys mit Willie Nelson und Waylon Jennings, Jerry Lee Lewis und Billy Joel auf. An einem denkwürdigen Abend sogar mit Timothy Leary, allerdings hätten auf diesem Konzert »alle Anwesenden auf einem anderen Planeten gekocht«.
Von Jerry Garcia über Ken Kesey, Abbie Hoffman und Keith Richards bis zu Iggy Pop kamen alle, um Friedman zu sehen. Bob Dylan lud ihn sogar auf seine »Rolling Thunder Revue« ein. Beim ersten Treffen der beiden sang Dylan Friedman zu Ehren »Ride ’em Jewboy«, was diesen aber nicht sonderlich beeindruckte: »Erwartest du jetzt etwa, dass ich irgendeinen deiner Songs spiele? Ich kann diese Scheiße nicht singen.«
Bei Friedman war es weniger die Musik, die für Aufsehen sorgte, als vielmehr die Texte. Deshalb hatten die Jewboys – wie ihr Drummer Major Bowles klagte – auch keine Groupies. »Alles, was wir hatten, waren jüdische Soziologieprofessoren, die sich Notizen machten.« Das Konzept der Provokation hatte nicht das Potential für ein großes Publikum. »Wir wollten die Welt schockieren, bis zu einem gewissen Grad«, sagte das Bandmitglied Jewford, und zwar mit einer Mischung aus Hank Williams und Lenny Bruce.
Die Dummheit der Antisemiten aufs Korn nehmen
Vermutlich waren auch die Texas Jewboys, die schon mit ihrem Namen provozieren und die Antisemiten herausfordern, direkt von dem jüdischen Stand-up-Comedian Lenny Bruce inspiriert, der andauernd wegen seiner obszönen und konfrontativen Witze festgenommen wurde. Die früher weitverbreitete Neigung, die Antisemiten nicht unnötig zu provozieren, schwand auch durch den selbstbewussten Bruce. Von da an nahm man die Dummheit der Antisemiten lieber aufs Korn, wie auch Friedman in seinem vielleicht bekanntestem Song »They Ain’t Making Jews Like Jesus Anymore«, in dem einem Redneck-Nerd in einem Bowling-Shirt, der die ganzen alten antisemitischen Klischees aufzählt, irgendwann Folgendes passiert: »Well I hit him with everything I had / Right square between the eyes / I say, ›I’m gonna gitcha, you son of a bitch ya, / For spoutin’ that pack of lies‹«. Ansonsten hatte Friedman selbstverständlich nichts gegen Jesus. Er verglich sich sogar immer wieder mit ihm: »Wie Jesus hatte ich weder Heim noch Frau noch Arbeit. Und wie Jesus war ich ein klapperdürrer Jude, der durch die Lande zog und Leute nervte.«
Aber Friedman schrieb auch grandiose poetische Texte, wie »Ride ’em Jewboy«, einen Song über den Holocaust, den er selbst in kleinen Spelunken sang und der die Juden, wie Friedman einmal meinte, verwirrt zurückließ. Auch hingebungsvolle Liebeslieder gehörten zu seinem Repertoire, wie »Marilyn and Joe«, in dem er den Zuhörern einen Ort verspricht, an den sie gehen könnten, wo Marilyn immer noch mit Joe DiMaggio und Romeo mit Julia tanzten und noch ein kleines Stück Gestern in den Augen sei, um den Träumern zu zeigen, dass sie niemals sterben werden.
Wie viele seiner Kollegen gewöhnte sich Friedman während seines Tour-Lebens ein bisschen zu sehr an Speed und Kokain. Die Band brach 1976 nach vier Jahren auseinander. Friedman machte weiter und trat für 6.000 Dollar wöchentlich im Lone Star Club in New York City auf, wo er Schauspieler wie Robin Williams und John Belushi zu seinen Gästen zählen durfte. Aber dann kündigte ihm sein Plattenlabel und die Show begann zu floppen. Tom Waits riet ihm, mit den Drogen aufzuhören – was er auch tat. 1985 zog er sich nach Texas in einen kleinen Wohnwagen auf der Farm seiner Eltern zurück und fing an, Krimis zu schreiben. Jedes Jahr einen, 17 Stück insgesamt.
10.000 Bücher über Jesus, Hitler und Bob Dylan
Die Hauptperson in diesen Krimis ist Friedman selbst, umgeben von den Village Irregulars, seinen Freunden aus New York, die in den Geschichten sehr unterschiedliche Rollen spielen. Da gibt es zum Beispiel Ratso, mit bürgerlichem Namen Larry Sloman, der immer im abgefahrensten Fummel herumläuft, mal als russischer Kosakentänzer, mal als schwuler Matador. Ratsos Wohnung ist mit über 10.000 Büchern über Jesus, Hitler und Bob Dylan vollgestopft und er hat »On the Road with Bob Dylan« geschrieben, eine Geschichte über die Rolling Thunder Revue, die Friedman als eine »traveling soap opera« bezeichnete.
Und dann war da noch Steven Rambam, auch im wirklichen Leben Privatdetektiv, und zwar einer der 25 besten des 20. Jahrhunderts, so die anerkannte »National Association of Investigative Specialists«. Rambam operiert weltweit und hat sich zur Aufgabe gemacht, Vermisste, Kriminelle und vor allem untergetauchte Nazi-Verbrecher zu suchen. Sein Statement dazu ist so einfach wie klar: »Als Jude versuche ich, ein Exempel zu statuieren. Ermordest du einen Juden, musst du damit rechnen, auch von einem Juden verfolgt zu werden, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren ist. Du wirst gejagt bis zu dem Tag, an dem du stirbst. Ich gebe mit meiner Jagd auf Kriegsverbrecher quasi eine Warnung. Die nächste Generation potentieller Judenmörder soll wissen, dass – wenn sie in diesem Sinne agiert – ihr Leben nicht so einfach wird. Ich versuche, ein Stück verlorene jüdische Ehre wiederherzustellen.«
Es spielen noch einige andere Kumpel mit, wie Willie Nelson und Abbie Hoffman, der Yippie-Anführer, der zusammen mit Jerry Rubin einer der »Typen« war, die die Sechziger erfunden hatten, und den Friedman einst vor der Bundespolizei versteckte, als er wegen eines Drogendelikts gesucht wurde, ein flackernder und paranoider Geist, der wie die Verkörperung des schlechten Gewissens der Amerikaner, die ihren Traum verraten hatten, umherirrt, wie ein langsam verblassender Mythos aus einer Zeit, die niemand mehr begreift.
Philosophie des Schwermuts und der Verzweiflung
Friedmans Krimis entziehen sich dem Genre auf elegante Weise, sie dienen ihm nur dazu, eine Philosophie des Schwermuts und der Verzweiflung auszubreiten und mit hinreißender Poesie seine Leser in sein winziges und aberwitziges Universum in der Vandam Street zu entführen, wo er Zwiegespräche mit seiner Katze führt, einen Puppenkopf verehrt wie ein afrikanisches Totem und über den Selbstmord nachsinnt. Die Handlung spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, manchmal fehlt sogar das, was den Fall überhaupt erst ausmacht, nämlich eine Leiche, und wenn endlich mal eine auftaucht, dann fehlt ein Motiv, das – wenn man Glück hat – am Ende des Buchs unvermittelt zusammengefrickelt wird.
Die Erörterung des dünnen Plots wird so lange durchgekaut und hin und her erwogen, dass man manchmal die Langmut der Leser bewundern muss, die ihm auch nach dem dritten Aufwärmen eines Witzes nicht böse sind. Dabei sorgt Friedman nicht selten auch für Verwirrung, wenn ihm Irrtümer unterlaufen, ein Handlungsfaden im Nirwana endet oder sich in Redundanzen zerfasert. Das also war offensichtlich nicht seine Stärke.
Friedmans Stärke lag in der Art und Weise des Erzählens, in seinem Sarkasmus, seinen Provokationen, seiner Lebensmüdigkeit, seinem Metapherngewitter, seinem Witz, seiner Misanthropie.
Seine Stärke lag vielmehr in der Art und Weise des Erzählens, in seinem Sarkasmus, seinen Provokationen, seiner Lebensmüdigkeit, seinen grandiosen Bildern, seinem Metapherngewitter, seinem Witz, seiner Misanthropie, seinen absurden und hintergründigen Dialogen. Als Protagonist seiner eigenen Geschichten hat er manchmal mehr damit zu tun, nicht unter den Sandsäcken des Lebens zu ersticken, als einen Fall zu klären. »Ich war kurz davor, mich an der Duschstange aufzuhängen. Um diese Zeit herum muss ich entdeckt haben, dass es hier gar keine Duschstange gab. Wenn man aus einem Fenster im ersten Stock sprang, nur um dann mit einiger Sicherheit auf einem Müllwagen zu landen, mochte das vielleicht einen witzigen und schmachvollen Nachruf ergeben, einen guten Abgang verschaffte man sich damit allerdings nicht. Wahrscheinlich war man hinterher gelähmt und musste über sich ergehen lassen, dass jedes frömmlerische und zerknirschte Arschloch, dem man je begegnet war, mit Schadenfreude im Herzen und Obstkorb in der Hand einen besuchen kam.«
Wo auch immer sich zähe existentielle Dramen abspielen, über die Kinky Friedman sich lustig macht, weil er selber da zu Hause ist, dort vergeht die Zeit auf eine ganz bestimmte Weise, und zwar so, »wie sie das in Krankenhäusern, Flughäfen, Bordellen, Bahnhöfen und Schlachthöfen macht: Sie strich vorbei wie ein Hobo in der Nacht, so langsam, so unbemerkt, so ruhig, dass man beinahe vergaß, dass es sie gab. Die Gegenwart vermischte sich mit der Vergangenheit, und längst Vergangenes lag einem auf einmal am Herzen, die Verstorbenen und Verfeindeten waren einem plötzlich lieb und teuer, und die perlenreichen Muschelstrände der Kindheit waren das leuchtende Herbstlaub im Hof eines alten Mannes.«
Bücher, die wie Antidepressiva wirken
Diese verantwortungslose Fröhlichkeit streut Friedman zwischen den trostlos erscheinenden Erkenntnissen ein, denen er damit auf listige Weise die niederdrückende Wirkung nimmt. Seine Bücher wirken wie Antidepressiva, und wer seinem Humor und seiner Poesie etwas abgewinnen kann, hat bei der Lektüre schon mal drei bis vier Stunden gewonnen, in denen er sich keine Gedanken darüber zu machen braucht, dass »jede Veränderung eine Verschlechterung ist«, wie es Joseph Heller einmal ausgedrückt hat.
Am 7. November 2006 ging Kinky Friedman als unabhängiger Kandidat bei den Gouverneurswahlen in Texas ins Rennen. Er wurde zwar nur vierter, aber er konnte erstaunliche 13 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Damals organisierte ich eine Wahlparty im Berliner Festsaal Kreuzberg, »Why the Hell Not? – Kinky for Governor«, aber genau zum Zeitpunkt der Veranstaltung fiel im gesamten Viertel der Strom aus, so dass wir ins Café Bellmann in der Wiener Straße umziehen mussten, das aus allen Nähten platzte.
2013 schließlich lernte ich ihn auf einem Konzert in Mainz kennen. Ich stand ein bisschen verloren herum, bis er schließlich auf mich zukam und ich mich als sein deutscher Verleger vorstellen konnte, der ihn in dem Buch »The Crazy Never Die« in eine Reihe mit Abbie Hoffman, Hunter S. Thompson und Lenny Bruce gestellt hatte. Er war voller überschwenglichen Lobs, und als ich ihm sagte, dass er den Aufsatz über sich doch gar nicht habe lesen können, meinte er, das sei doch vollkommen egal, er wisse auch so, dass der Artikel großartig ist.
Kinky Friedman, der große Außenseiter, ist nach langer Krankheit am 26. Juni mit 79 Jahren auf seiner Ranch in Texas gestorben.

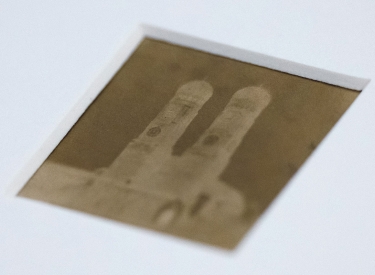



 Das Endspiel, das kein Endspiel ist
Das Endspiel, das kein Endspiel ist