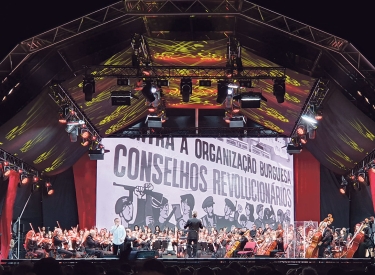Lizenz zum Landraub
Auch mehr als drei Jahrzehnte nach ihrer endgültigen Vertreibung vermisst Annette* den Wald noch immer. Die alte Mutwa lebt unweit eines der Eingänge zum Bwindi Impenetrable National Park in Uganda. 700 US-Dollar zahlen ausländischen Touristen, um dieses Unesco-Weltnaturerbe betreten und vielleicht eine Stunde mit Berggorillas verbringen zu dürfen – Anfahrt und Unterkunft nicht eingeschlossen. Annette lebt in einer behelfsmäßigen zeltartigen Hütte, die kaum länger ist als sie groß. Eine blaue Plastikplane schützt sie vor dem mitunter heftigen Regen in dieser Region.
Die Europäer nannten Menschen wie Annette »Pygmäen«. Frühe koloniale Naturschützer erklärten sie zu edlen Wilden, die im Einklang mit der Natur lebten und somit sogar in Naturreservaten toleriert werden könnten. Ähnlich dachte man auch über andere Gruppen mit vermeintlich »ursprünglichen« Lebensweisen. Als sich jedoch herausstellte, dass Menschen und ihre Art zu leben sich nicht wie Zebras konservieren lassen, wandte man sich gegen sie. Beginnend mit der Kolonialherrschaft wurde das Recht der Batwa (so der Plural von Mutwa), die Ressourcen des Waldes zu nutzen, sukzessive eingeschränkt.
Seit den späten achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gelang es dem dem ugandischen Staat mit Hilfe internationaler Geber, Kapazitäten aufzubauen, um die zuvor häufig nur auf dem Papier bestehenden Regularien auch durchzusetzen. 1991 wurden schließlich die Nationalparks Bwindi und Mgahinga ausgewiesen.
Dies zementierte eine Existenz, die Annette als »das härteste Leben« beschreibt. Menschenrechtler zählen die Batwa zu den am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen der Welt. Der Distrikt Kisoro beherbergt Mgahinga und den südlichen Sektor von Bwindi. Die Hälfte der Batwa, die hier leben, wohnt in temporären Behausungen. Viele siedeln ohne Rechtstitel auf fremdem Land. Annette berichtet, eine ihrer Enkelinnen könne nicht mehr zur Schule gehen, weil selbst diese bescheidenen Kosten für die Familie zu hoch sind. Nur etwa zwei Prozent der Batwa in der Umgebung der Parks hat wenigstens die Mittelschule abgeschlossen. Die Abbrecherquote bleibt hoch.
Die Europäer nannten Menschen wie Annette »Pygmäen«. Frühe koloniale Naturschützer erklärten sie zu edlen Wilden, die im Einklang mit der Natur lebten und somit sogar in Naturreservaten toleriert werden könnten.
Ob der 1872 gegründete erste US-amerikanische Nationalpark Yellowstone, der 1925 etablierte erste afrikanische Nationalpark Virunga im Kongo oder Tansanias berühmte Serengeti – um Orte der »Wildnis« zu schaffen, mussten häufig die Menschen weichen, die dort lebten und wirtschafteten. Notfalls wurden sie mit Gewalt vertrieben, nicht selten mit dramatischen sozialen Konsequenzen für die Betroffenen. Meist waren es jene, die sowieso bereits marginalisiert waren, die von derartigen Maßnahmen am härtesten getroffen und bei den Kompensationen übergangen wurden. Naturschutzbehörden im sogenannten Globalen Süden wiederum wurden aufgerüstet, um diese Ausgrenzung notfalls mit militarisierter Gewalt durchsetzen zu können. Insbesondere in Afrika ist die Situation vieler Schutzgebiete weiterhin vertrackt.
Den Touristen erzählen die Ranger in Bwindi heutzutage mitunter seltsam unbeschwert von der Vertreibung. Sie sei notwendig gewesen, weil die Batwa durch die Jagd einen bedrohlichen Raubbau an den Ressourcen der Parks betrieben hätten. Doch Belege für solche Behauptungen sind rar. Hinweise gibt es hingegen darauf, dass einige Ranger vor der Gründung der Parks selbst in die Gorilla- und Elefantenwilderei verstrickt waren.
Sucht man in Archiven nach den Berichten der Naturschützer, die, gesponsert von Organisationen wie der US-amerikanischen Wildlife Conservation Society oder dem World Wide Fund for Nature (WWF), auf die Gründung des Bwindi-Nationalparks hinarbeiteten, so fällt vor allem eines auf: Dass die Batwa nach den Jahrzehnten der Vertreibung kaum eine Rolle spielen. Welche Auswirkungen ein strikterer Schutz der Wälder im südlichen Uganda auf sie haben würde, war bestenfalls eine Randnotiz wert.
Geht es nach Naturschützern, sollen bis 2030 nicht weniger als 30 Prozent des Planeten unter Schutz gestellt werden. Diesem Ziel, 30×30 genannt, haben sich 2022 auf der Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen fast alle Staaten der Welt angeschlossen. Führende Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und internationale Organisationen aus dem Naturschutzsektor beteuern seit Jahrzehnten, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben – doch die potentiellen sozialen Implikationen von 30×30 hat man kaum untersucht.
Die Lage der Batwa zeigt zudem, dass internationale Organisationen sich sogar schwer damit tun, Wiedergutmachung für eine Gruppe von wenigen Tausend Individuen zu leisten. In den Jahrzehnten nach ihrer Vertreibung haben Institutionen wie die Weltbank, staatliche Entwicklungsagenturen aus Industrieländern sowie lokale und internationale Naturschutz- und Entwicklungshilfe-NGOs rund um Bwindi und Mgahinga Projekte umgesetzt oder finanziert – oft behaupteten sie, auch die Armut der die Parks umgebenden Bevölkerung lindern zu wollen. Dennoch leben viele Batwa noch immer in prekärsten Umständen.
Manche Organisationen und Behörden im Naturschutzsektor scheinen zudem allen Lippenbekenntnissen zum Trotz nur wenig gelernt zu haben. So wurde 2019 bekannt, dass vom WWF finanzierte Wildhüter in mehreren zentralafrikanischen Ländern schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gegen lokale Community’s begangen hatten. Mitarbeiter der Organisation wussten den Recherchen zufolge davon, griffen aber weder wirksam noch rechtzeitig ein.
Die Regierung Tansanias wiederum versucht seit mehreren Jahren, die Maasai aus einer Region im Norden des Landes unweit der Serengeti zu vertreiben, um Naturschutzgebiete zu erweitern – nicht zuletzt auch zum Jagdvergnügen von Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Eine Reporterin der Zeitschrift The Atlantic dokumentierte Anfang dieses Jahres zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gegen die Maasai, die als Hirten von kleinbäuerlicher Viehhaltung auf Naturweiden leben. Internationale Naturschutzorganisationen protestieren selten vernehmlich gegen derartige Vorgehensweisen.
Doch auch wenn einige Naturschützer ernsthaft versuchen, ihre Methoden zu reformieren, so hat der Emissionshandel in der Zwischenzeit neue finanzielle Anreize für Staaten und Unternehmen geschaffen, den – vermeintlich – effektiveren Schutz von Wäldern und anderen CO2 absorbierenden Ökosystemen mit autoritären Mitteln voranzutreiben. Dafür erhalten sie dann handelbare Emissionsminderungsgutschriften, die das CO2 abbilden sollen, das durch die – hypothetische – Zerstörung eines solchen Ökosystems freigesetzt würde. Mit dem Erwerb derartiger Zertifikate können Unternehmen ihre Emissionen kleinrechnen und Produkte als »klimaneutral« vermarkten.
Eine Reihe von Skandalen hat die Glaubwürdigkeit dieses sogenannten freiwilligen Kohlenstoffmarkts und insbesondere von Waldschutzprojekten in den vergangenen Jahren stark beschädigt. Untersuchungen zeigten, dass viele Projekte die Entwaldung nicht signifikant reduziert hatten, und wo es doch einen Effekt gab, war dieser oft deutlich geringer als behauptet.
Der Emissionshandel hat neue finanzielle Anreize für Staaten und Unternehmen geschaffen, den – vermeintlich – effektiveren Schutz von CO2 absorbierenden Öko-systemen mit autoritären Mitteln voranzutreiben.
Was medial weit weniger Aufmerksamkeit erhielt als derartige Manipulationen: Ausgerechnet arme ländliche und indigene Gemeinden im Globalen Süden mussten immer wieder den Preis für dieses Greenwashing bezahlen. Jene also, die am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind. Ein am Center for Environmental Public Policy der University of California, Berkeley, ansässiges Forschungsprojekt untersuchte unlängst das Rahmenwerk zur Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Degradierung von Wäldern (REDD+), an dem sich viele für den freiwilligen CO2-Handel gedachte Waldschutzprojekte im Globalen Süden orientieren. Gedacht war es dazu, armen Ländern finanzielle Anreize zu bietet, Entwaldung zu vermeiden. Doch die Autoren der Analyse konstatierten: »Fast alle Projekte konzentrieren sich darauf, das Verhalten einiger der ärmsten Gemeinschaften der Welt zu ändern.«
Die wichtigsten kommerziellen Triebkräfte der Entwaldung wie die großflächige Landwirtschaft, Viehzucht, Holzproduktion oder den Bergbau bekämpften diese Projekte hingegen nicht. Wenn Restriktionen durchgesetzt wurden, habe dies also in der Regel vor allem schwächere Haushalte und Gemeinschaften am härtesten getroffen und in den schlimmsten Fällen zu Vertreibungen oder Enteignungen geführt, so das Forschungsprojekt aus Berkeley.
Die Beteiligten am CO2-Business beteuern weiterhin, dass ihre Projekte lokalen Communitys zugute kämen und man deren Recht respektiere. Journalisten und Menschenrechtler dokumentierten jedoch immer wieder Vertreibungen und andere Menschenrechtsverletzungen, die mit dem CO2-Handel in Verbindung stehen, sowie ausbleibenden Nutzen für lokale Gemeinden.
Kenias Präsident William Ruto träumt dennoch von Afrikas Kohlenstoffsenken als einer »beispiellosen wirtschaftlichen Goldmine«. Auch viele andere afrikanische Staaten hoffen weiterhin auf gute Geschäfte, die kaum Investitionen erfordern. All das erinnert an den Enthusiasmus für Naturschutzgebiete und internationalen Tourismus, der einige afrikanische Länder in den sechziger und siebziger Jahren erfasste – oft mit negativen Konsequenzen für ländliche Gemeinden.
Neben dem in Verruf geratenen freiwilligen Kohlenstoffmarkt setzt man auf Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens. Dieser erlaubt reichen Staaten einem Teil ihrer verbindlichen Klimaschutzverpflichtungen nachzukommen, indem sie Gutschriften kaufen, die emissionsmindernden Projekten in anderen Ländern entstammen. Allerdings ist strittig, ob REDD+-Projekte hierfür in Frage kommen. In der Zwischenzeit zieht der CO2-Handel dubiose private Firmen an, denen Staaten in der Hoffnung auf das große Geschäft erhebliche Macht zugestehen. Das eng mit Dubais Herrscherfamilie verbandelte Unternehmen Blue Carbon beispielsweise sondiert derzeit die Nutzung von Millionen Hektar Land in Tansania, Liberia, Sambia und Kenia. Die Verhandlungen sind intransparent. Mit Simbabwe schloss das Unternehmen ein Abkommen über die Nutzung eines Fünftels der Landesfläche ab.
Derweil drohen auch in Rutos Kenia lokale Gemeinden erneut ins Hintertreffen zu geraten. Im Mau-Wald gehen Ranger seit einiger Zeit wieder verstärkt gegen die Ogiek vor. »Wir leben in absoluter Angst«, zitierte der Guardian im November einen Vertreter der Community. »Am ersten Tag fingen sie an, Häuser mit Äxten, Hämmern und Macheten einzureißen. Sie zerstörten die Schule und am zweiten Tag fingen sie sogar an, einige Häuser niederzubrennen.« Die Ogiek lebten einst wie die Batwa als Jäger und Sammler, heutzutage halten viele Rinder oder betreiben Ackerbau. Auch unter ihnen gibt es viele, die nicht wissen, wohin, wenn ihnen ihr Land genommen werden sollte.
Menschenrechtler vermuten einen Zusammenhang mit Rutos Enthusiasmus für Emissionszertifikate. Ob nun Naturschutz oder kommerzielle Interessen hinter der Vertreibung stecken: Die Regierung gibt sich kompromisslos. »Diejenigen, die sich noch im Wald aufhalten, sollten so schnell wie möglich verschwinden, denn wir werden einen Zaun errichten, und das ist keine Bitte«, warnte Ruto öffentlich. Dabei hatte der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte die kenianische Regierung wegen ihres Umgangs mit den Ogiek bereits 2017 und 2022 verurteilt.
In den vergangenen Jahren setzten sich viele Batwa und andere von repressiven Naturschutzmaßnahmen betroffene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Mitteln gegen ihre Marginalisierung zur Wehr. In der Demokratischen Republik Kongo besetzten Hunderte Batwa im Oktober 2018 nach Jahrzehnten voller gebrochener Versprechen einen Teil des Kahuzi-Biéga-Nationalparks. Aus dessen Territorium waren sie während der sechziger und siebziger Jahren vertrieben worden – nicht zuletzt auf das Werben internationaler Naturschützer hin, die dem Mobutu-Regime internationales Prestige durch die Einrichtung neuer Schutzgebiete versprochen hatten. Recherchen der Minority Rights Group zufolge wurden bei dem Versuch der nationalen Naturschutzbehörde, die Kontrolle über das Gebiet mit Unterstützung der Armee wiederherzustellen, ganze Dörfer niedergebrannt. Mehrere Batwa sollen getötet oder verstümmelt worden sein.
In Uganda hat eine lokale NGO im Namen der Batwa eine Petition vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Rund acht Jahre später bekamen sie recht: 2021 beauftragten die Richter den High Court damit, Maßnahmen zu bestimmen, die zugunsten der Batwa ergriffen werden müssen, um ihre »entsetzliche Situation« zu verbessern. Die Regierung habe den Batwa keine angemessene Entschädigung für den Verlust ihres Landes gezahlt, so dass sie nicht in der Lage gewesen seien, anderes Land zu erwerben. Dies habe nicht nur ihre Lebensgrundlage zerstört, »sondern auch ihr Selbstwertgefühl und ihre Identität als Volk«.
Sowohl die ugandische Naturschutzbehörde als auch der Generalstaatsanwalt legten Berufung gegen die Entscheidung ein. Seitdem liegt der Fall beim Supreme Court in Kampala. »Wir glauben, dass die Beweise ausreichen, um den Status quo beizubehalten«, sagte ein Sprecher der Naturschutzbehörde. Man habe keinen Entschädigungsplan für die Batwa.
*Name von der Redaktion geändert


 Mahnwache im Kiez
Mahnwache im Kiez