Gefangen an der Grenze
»Da drin sind die Satellitentelefone, sie müssen so schnell wie möglich übergeben werden«, sagt die Inhaberin der Wohnung und zeigt auf ein Paket. Es ist schon die zweite Warschauer Adresse, bei der wir vorbeifahren, um Sachen für die Grenze abzuholen. »Das ist jetzt das Wichtigste, damit wir mit ihnen kommunizieren können. Fahrt vorsichtig und passt auf euch auf – für Späße ist jetzt nicht die Zeit«, mahnt die Frau, bevor sie die Tür hinter uns schließt.
Der polnische Grenzschutz lässt die Menschen mitten im Wald zurück oder direkt beim belarussischen Militär, das sie wiederum zum Umkehren zwingt. Und so geht es immer weiter.
Es wird nicht einfach werden, die Satellitentelefone zu übergeben: Die Menschen im Wald sind von allen Seiten von Grenzsoldaten umgeben. Menschenrechtler dürfen sich ihnen nicht nähern.
20 Minuten später sind wir auf der Autobahn. Wir sind zu fünft und fahren in zwei Autos. Von Warschau bis zur Grenze zu Belarus sind es vier Stunden.
Polizeikontrolle
Wir nähern uns dem Dorf Usnarz Górny, in dessen Nähe 32 Personen, auf beiden Seiten eingekesselt von Soldaten, in einem Wald festsitzen. Es wird langsam dunkel. Das Dorf ist nur noch zehn Kilometer entfernt, als auf der Gegenfahrbahn eine Grenzpatrouille erscheint. Sekunden später schalten die Soldaten die Sirene ein. Nachdem sie unsere Papiere kontrolliert haben, fragen die Grenzbeamten nach dem Zweck unseres Besuchs. Sie wollen wissen, wofür wir so große Autos brauchen – wir sind mit Kleinbussen gekommen.
»Ich will ganz direkt sprechen: Sie haben große Autos, also sind Sie Objekt unserer verstärkten Aufmerksamkeit, verstehen wir uns?« fragt der Grenzbeamte.
»Wir machen nur unsere Arbeit.«
»Wir machen unsere auch«, versichert der junge Mann und notiert die Kennzeichen der Autos, Personendaten und den Kilometerstand.
Ein paar Minuten später sind wir im Dorf. Wir halten bei einem Geschäft, eine neue Streife kommt um die Ecke. Die Situation wiederholt sich.
»Wofür haben Sie so große Autos?« stellt der nächste Grenzbeamte die gleiche Frage.
»So sind sie nun mal.«
»Wissen Sie, hier ist es nicht sicher, es wäre besser, wenn Sie zurückfahren«, sagt der Beamte und notiert unsere Daten
»Machen Sie sich keine Sorgen um uns«, antworte ich höflich.
Das Dorf ist praktisch unbeleuchtet – ringsherum ist nur Wald. Es liegt ein Gefühl der Spannung in der Luft. Bis vor kurzem fuhr hier nur ein Auto am Tag vorbei, jetzt sind überall Polizeistreifen, Medien und Menschenrechtler, und dazwischen die verschüchterten Einheimischen.
Die Parteien des Konflikts …
Im August dieses Jahres hat die EU ihre Sanktionen gegen Belarus verschärft. Als Reaktion darauf begann die belarussische Regierung, eine Migrationskrise an den Grenzen des Landes zu Polen, Litauen und Lettland zu schüren. Der Plan ist ganz einfach: Belarus erlaubt Flüchtlingen die Einreise per Flugzeug, dann bringt man sie an die Grenze zu Polen, Litauen oder Lettland, von wo aus sie versuchen sollen, in die EU einzureisen. Indem Belarus sich als Transitland anbietet, erzeugt es Probleme für die EU – und verschafft sich selbst Devisen. Denn ein Visum für Belarus zu bekommen, ist zwar einfach, aber teuer.
In arabischsprachigen Facebook-Gruppen wird darüber informiert, wie man nach Belarus gelangt, Anzeigen nennen einen Preis und eine Telefonnummer. Nach der Ankunft in Minsk werden die Menschen zur Grenze gebracht, die sie eigenständig überqueren sollen. Die verlangten Preise reichen von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend US-Dollar.
Polen betreibt seinerseits eine illegale Pushback-Politik und bezeichnet Menschen, die vor Krieg fliehen, beharrlich als »illegale Migranten«. Pushback heißt, dass Grenzbeamte Menschen zurück über die Grenze des Landes drängen, aus dem sie gekommen sind. Diese Praxis stellt einen Verstoß gegen die Verfassung und die Genfer Konvention dar.
Wenn eine Person ohne Visum oder anderen Rechtstitel die Grenze überschreitet, ist sie illegal eingewandert. Aber sobald sie erklärt, dass sie Asyl beantragen will, ist sie ein Flüchtling. Die Einwanderungsbehörden sind verpflichtet, den Antrag der Person in einem ordentlichen Verfahren zu prüfen. Bis die zuständige Behörde eine Entscheidung über die Anerkennung des Flüchtlingsstatus einer Person getroffen hat, muss das fragliche Land ihr ein Dach über dem Kopf, Wasser und Nahrung geben – das sind Garantien des internationalen Rechts.
Die polnischen Behörden sprechen jedoch offiziell nicht von Flüchtlingen. Es gebe nur illegale Grenzübertritte durch Personen mit belarussischen Visa, die von den belarussischen Behörden nicht wieder hereingelassen werden würden. Deshalb greifen polnische Grenzschützer Menschen in den Grenzwäldern und -dörfern auf und bringen sie zurück nach Belarus. Sie zerstören dabei deren Handys, damit sie nicht mehr kommunizieren und das Geschehen nicht aufzeichnen können. Die Menschen werden mitten im Wald zurückgelassen oder direkt beim belarussischen Militär, das sie wiederum zum Umkehren zwingt. Und so geht es immer weiter.
… und dessen Opfer
Menschenrechtler überwachen die Grenzgebiete ebenfalls und versuchen, Flüchtlinge, die aus den Wäldern kommen, zu finden, bevor die Grenztruppen es tun. Gelingt ihnen das, notieren sie schnell Personendaten und tauschen Telefonnummern aus. Sie können auch Vollmachten unterzeichnen, dank derer Flüchtlinge zu Klienten einer Menschenrechtsorganisation werden, so dass diese ihnen einen Anwalt zur Verfügung stellen kann. In der Theorie zumindest. In der Praxis halten polnische Grenzschützer Anwälte von ihren Mandanten fern, vernichten Vollmachten und bringen die Flüchtenden zurück in den Wald.
Mit den Flüchtenden, die im Gebiet des Grenzverlaufs kampieren und von Grenztruppen auf beiden Seiten eingekesselt sind, können die Hilfsorganisationen nicht mehr sprechen. Sie versuchen deshalb, per Megaphon zu kommunizieren, und ihnen Fragen zu stellen, die man mit »ja« oder »nein« beantworten kann. Manchmal gelingt es ihnen, Nachrichten auszutauschen, manchmal unterbinden Grenzbeamte das, indem sie die Motoren ihrer Fahrzeuge starten. Dann ist nichts mehr zu verstehen.
Die Opfer von Lukaschenkos Betrug und der Migrantenphobie der polnischen Regierung stammen vor allem aus Afghanistan, Irak, Syrien und dem Kongo sowie vereinzelt aus Somalia, Jemen, Ägypten, Kamerun und Tadschikistan. Die Flüchtlinge an der Grenze, die viel Geld für die Reise bezahlt haben, hatten keine Ahnung, dass sie als Werkzeug für Lukaschenkos Zwecke dienen würden. Sie haben weder warme Kleidung noch Medikamente oder Lebensmittel dabei, keinen Kontakt zu Familien und Angehörigen, niemanden, an den sie sich um Hilfe wenden könnten. Sie trinken oft Wasser aus sumpfigen Bächen und essen gefundene Äpfel und Mais.
»Nachts fliegen Hubschrauber herum«
Eine Gruppe junger Leute steht vor dem Dorfladen und hat einen Lautsprecher auf die Treppe gestellt. Sie hören Rapmusik und lachen – sie sind wahrscheinlich die einzigen Menschen hier, deren Verhalten nicht angespannt wirkt.
Ein paar Journalisten kommen um die Ecke und diskutieren lautstark über die Situation an der Grenze. Einer von ihnen stößt fast mit einer jungen Frau zusammen.
»Zu viele Leute in letzter Zeit, das muss ungewöhnlich sein, oder?« frage ich, während ich zu ihr hinübergehe.
»Sehr viele. So viele habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen«, antwortet sie. »Nachts fliegen Hubschrauber herum und beleuchten die Straßen. Es ist gruselig, wenn man diesen Lichtstrahl sieht. Es ist beängstigend, wie sie mit den Leuten spielen. Ich weiß nicht, wer recht hat. Und ich werde es wohl auch nie wissen. Ich weiß nur, dass die Menschen im Wald zu Spielzeugen geworden sind und dass das unmenschlich ist.«
Eine andere Streife fährt an uns vorbei, hält kurz an. Die Frau schaut misstrauisch, redet aber weiter. »Neulich hörte ich einen Schuss von der Waldseite. Meine Knie wurden weich. Kann dieser Konflikt nicht auf menschliche Weise gelöst werden?«
»Es fällt mir schwer«
Ende August erklärte sich Polen bereit, Belarus zu helfen und die Menschen in den belarussischen Wäldern (denn in den polnischen Wäldern gebe es ja keine Flüchtlinge) zu versorgen. Zu diesem Zweck hat die polnische Regierung Lastwagen mit humanitärer Hilfe (Zelte, Decken und Hygieneartikel) geschickt und Belarus offiziell gebeten, die Hilfe anzunehmen.
Wir fahren bis zum Grenzübergang und suchen einen Konvoi. Nach fünf Minuten Fahrt entlang der LKW-Schlange finden wir den richtigen. Der Fahrer schlendert gelangweilt um das Auto herum. Ich versuche, mit ihm zu reden, aber er flüchtet in die Kabine und schließt die Tür hinter sich.
Polen weiß, dass Belarus keine Hilfe annehmen wird, aber es geht nicht um die Hilfe – wichtig ist die Geste.
Es ist schon spät, also beschließen wir, die Nacht im Haus eines uns bekannten Anwohners zu verbringen. Wir vereinbaren, dass, wenn eines unserer Autos angehalten wird, das andere weiterfahren und versuchen soll, die Grenzbeamten nicht zum Haus des Mannes zu führen.
Es ist dunkel, wir fahren langsam, um keine Rehe anzufahren. Eine Minute später tauchen hinter uns Grenzpolizisten auf und wir müssen anhalten. Das andere Auto schafft es, abzubiegen.
Vier Grenzschutzbeamte steigen aus. Zwei von ihnen sind in voller Montur: Westen, Masken und Sturmgewehre. Der eine ohne Maske ist sehr jung, er sieht aus wie 20. Der Ältere fragt nach unseren Dokumenten.
»Wo ist das zweite Auto?« fragt der Grenzbeamte. »Sie hatten zwei.«
»Es ist weitergefahren.«
»Wohin?«
»Das wissen wir nicht, wir sind ihnen nur nachgefahren.«
»Können Sie anrufen und fragen, wo sie hingefahren sind?«
»Wir haben kein Netz.«
Der Grenzbeamte nimmt unsere Dokumente und geht zu seinem Auto, während die beiden mit den Sturmgewehren am Straßenrand stehen bleiben. Er versucht, unsere Daten am Telefon durchzugeben. Doch man versteht ihn nicht. Es gibt hier wirklich kein polnisches Handynetz, nur das belarussische.
Schließlich kommt er mit den Dokumenten zurück.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen?« frage ich.
»Bitte.«
»Was denken Sie über all das?«
»Es fällt mir schwer.«
»Menschlich oder die Arbeit?«
»Menschlich«, antwortet der Grenzbeamte. »Die Arbeit auch«, fügt er nach ein paar Sekunden hinzu.
Wir parken auf dem Grundstück eines Anwohners. Es gibt keine Straßenlaternen in der Nähe, die einzige Lichtquelle ist das Haus am Rande des Waldes. Der Himmel ist mit Wolken bedeckt. Es ist feucht. Still.
Uns öffnet ein Mann mit traurigen Augen und einem freundlichen Gesicht. Am Eingang seines Hauses leckt mir ein großer weißer Hund die Hand.
»Ich bin vor ein paar Jahren hierhergezogen. Damit ich es ruhig habe«, sagt der Besitzer des Hauses. »Bis vor einer Woche kamen die Grenzbeamten aus Langeweile immer zu uns zum Teetrinken. Es waren nette Leute. Und jetzt klopfen sie mit Gewehrkolben gegen die Autoscheiben und kontrollieren die Papiere.«
»Wir wurden auf den letzten zehn Kilometern viermal angehalten«, antworte ich. »Einer der letzten Grenzbeamten war sogar freundlich.«
»Was ich nicht verstehe, ist, warum sie diese Nazi-Befehle befolgen.« Der Mann stellt erregt einen Teller mit Nudeln auf den Tisch.
»Warum zwingen sie erschöpfte Menschen, wieder über Stacheldraht zu klettern? Warum weigern sie sich nicht? Wenn sie sich weigern, werden sie nicht vor ein Tribunal gestellt. Pushbacks verstoßen gegen die Verfassung, was sie tun, ist illegal. Sie haben einen Eid auf die Verfassung geschworen, nicht auf die Behörden! Warum ist das eigene Gehalt wichtiger als das Leben eines anderen?«
Das Camp
Es ist sieben Uhr morgens, leichter Nebel, der Boden ist feucht und es ist kalt.
Das Lager der Flüchtlingshelfer und Menschenrechtler besteht aus vier Zelten und etwa zehn Autos.
Unmittelbar vor dem Lager stehen Grenzsoldaten in einer Reihe und kontrollieren den Zugang zu der Gruppe von Flüchtlingen. Vor ein paar Tagen konnte man sich den Menschen noch nähern, aber jetzt sind die Aktivisten so weit zurückgedrängt worden, dass sie niemanden mehr sehen können.
»Es ist kalt, die Menschen im Wald sind schon krank. Viele haben Bauchschmerzen, wahrscheinlich wegen des Wassers. Hier gibt es Sümpfe«, sagt eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation.
Ein paar Tage später wird mir ein Mitarbeiter der polnischen Organisation »Brot und Salz« von einer schwangere Frau erzählen, die zwei Wochen im Wald verbracht hatte, und von einem Mann mit Diabetes, der in Kältestarre war, für den jedoch kein Krankenwagen gerufen wurde. Und weiter: »Die Menschen zeigten uns blaue Flecken von Schlägen und erzählten uns, dass die Grenzsoldaten Hunde auf sie losließen. Und als sie den Belarussen sagten, dass sie nicht mehr nach Polen wollten, sondern nur weg, fingen diese an, vor ihre Füße zu schießen, und zwangen sie, wieder rüberzugehen.«
Am Sonntag wird der polnische Grenzschutz die ersten Leichenfunde melden: Es sind drei Männer aus dem Irak.
Wir fahren an der Grenze entlang. Hinter der von Grenztruppen bewachten Grenzlinie hat Polen bereits etwa einen Meter hohen Stacheldraht verlegt. Im vergangenen Monat übergab die Ukraine 38 Tonnen desselben Drahts im Rahmen humanitärer Hilfe an Litauen.
Es wird nicht lange dauern, bis Bilder von verletzten Beinen im Internet auftauchen. Eine Woche später veröffentlichen belarussische Grenzschützer ein Video eines verstümmelten Kadavers eines Rehs, das in einen Draht gelaufen war.
Wir fahren auf der leeren Straße nach Warschau zurück.
Es gibt keine Zeugen mehr
Wenige Tage später, am 6. September, ruft die polnische Regierung den Ausnahmezustand aus, und Medien, Flüchtlingshelfer und Menschenrechtler müssen Teile des polnisch-belarussischen Grenzgebiets vor Mitternacht verlassen. Die Autos der Aktivisten bilden am Ausgang eine Schlange, während Militär- und Polizeifahrzeuge in die andere Richtung fahren.
Wenige Tage später beginnt in Warschau eine Protestaktion. Menschen versammeln sich vor dem Sejm, dem polnischen Parlament, um ihre Solidarität mit Migranten und Flüchtlingen zu bekunden. Eine Gruppe schlägt ein Lager auf und beginnt einen Hungerstreik. Es sind mehr Polizisten als Demonstranten da.
Bald darauf schließen sich Menschenrechtsorganisationen zu einer Monitoringgruppe zusammen, die die Geschehnisse in den Grenzgebieten, die sich nicht im Ausnahmezustand befinden, weiter beobachtet. Aktivisten reisen in Grenzdörfer und erklären den Einheimischen, wie sie Flüchtlingen helfen können, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. Doch im im Grenzgebiet bei Usnarz Górny gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Es gibt keine Zeugen mehr.
In der Nacht zum 18. September fällt die Temperatur auf drei Grad. Am 19. September meldet der polnische Grenzschutz die ersten Leichenfunde: Es sind drei Männer aus dem Irak. Am selben Sonntag berichtet der belarussische Grenzschutzdienst über den Fund einer weiblichen Leiche direkt an der Grenze zu Polen.
In dem Bericht steht, in der Nähe des Leichenfundortes habe es deutliche Anzeichen dafür gegeben, dass die Leiche von Polen nach Belarus geschleppt wurde. Des Weiteren heißt es: »Zu der Leiche gehörten drei Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren sowie ein Mann und eine ältere Frau. Nach ihren Angaben wurden sie gezwungen, zu Fuß zur Grenze zu gehen und dann mit vorgehaltener Waffe die polnisch-belarussische Grenze zu überqueren.« Am Freitag meldeten die polnischen Grenzbehörden, dass ein weiterer Iraker unweit der Grenze zu Belarus tot aufgefunden wurde.
Dieser Text entstand im Rahmen des Projekts »Schule der Sozialreportage« mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Ukraine. Er erschien zuerst in der Zeitschrift Krytyka Polityczna (Politische Kritik) und ist leicht gekürzt und bearbeitet. Übersetzung aus dem Russischen von Paul Simon.

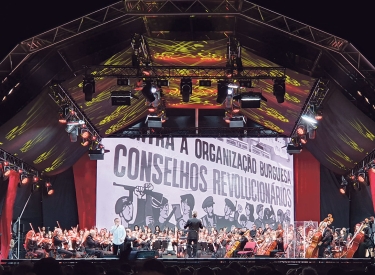
 Im Namen der Nelke
Im Namen der Nelke

