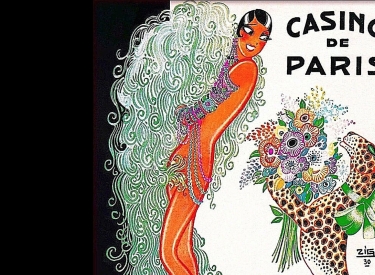Unzulässige Assoziationen
Wie sollen Historikerinnen und Historiker reagieren, wenn sich ihnen bei der Forschung zum Nationalsozialismus Parallelen zu gegenwärtigen Ereignissen aufdrängen? Dieser Frage ging Johannes Spohr nach (Jungle World 13/2020).
Das Leben einer Historikerin nimmt bisweilen schizophrene Züge an. Während man einerseits in seinem Forschungsgegenstand versinkt, der in vergangenen Zeitepochen verborgen liegt, bewegt man sich gleichzeitig in der gegenwärtigen Gesellschaft. Man agiert in ihr, die, weil sie nicht die befreite ist, weiterhin eine Menge an Gewalt, Leid und Elend aller Art parat hält.
So unfassbar und grausam das Attentat von Hanau war, das Ereignis lässt sich nicht ohne Relativierungen mit Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus vergleichen.
Herrschaft und Ausbeutung bestehen kontinuierlich fort, und die Vorgeschichte, wie Marx eine Epoche nannte, in der Menschen zwar Geschichte machen, aber nicht aus freien Stücken, ist nicht verlassen worden. So wirkt auch der Gegenstand der historischen Forschung in die Gegenwart. Als fortwährender kann er nicht abschließend verarbeitet werden, er wirkt auf verschiedene Weise weiter. Das trifft besonders auf den Nationalsozialismus zu, der sich Historikerinnen dementsprechend als historisches Problem in seiner ganzen Gegenwärtigkeit darstellt. Man muss Johannes Spohr (Jungle World 13/2020) diesbezüglich recht geben: Bei Historikern und Historikerinnen, die sich mit der Geschichte der vom Nationalsozialismus beeinflussten Gesellschaften beschäftigen, werden Assoziationen durch den gegenwärtigen rechten Terror hervorgerufen. Zu problematisieren wäre jedoch: Was wird aus diesen Assoziationen gemacht?
Es gibt in jeder Disziplin Dinge, die bei wissenschaftlichem Arbeiten als no-go gelten. Die beiden schlimmsten Fauxpas sind für Historiker und Historikerinnen: Erstens der Verzicht auf Quellenbelege, wodurch Verallgemeinerungen und Behauptungen nicht überprüft werden können; zweitens allzu freie Assoziation und Parallelisierung geschichtlicher Begebenheiten. Dadurch besteht die Gefahr, dass historischen Ereignissen ihre Spezifik genommen wird. Auch Spohr sieht eine solche Gefahr der alarmistischen Überzeichnung, die »wenig zu einem besseren Verständnis beitragen« kann. Ohne Reflexion der Quellen lasse sich Vergangenes nicht zufriedenstellend analysieren, sondern vielmehr politisch instrumentalisieren. Doch genau das hat er getan. Obwohl Spohr in seinen »Assoziationen mit dem Unvergleichbaren« durchaus hellsichtig allgemeine Entwicklungen und Kontinuitäten ausweist, verliert er sich in ihnen.
Eine Kontinuität rechter Gewalt seit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus lässt sich nicht von der Hand weisen. Betroffene fühlen und fühlten sich oft alleingelassen. Dass staatliche Handlungen gegen rechte Gewalt wenig motiviert sind, geringen Erfolg haben und rechte Motive heruntergespielt werden, ist nicht erst seit dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni vorigen Jahres offenkundig. Doch die Art und Weise, wie Spohr seine Überlegungen zu belegen versucht, ist problematisch. So unfassbar und grausam das Attentat von Hanau war, das Ereignis lässt sich nicht ohne Relativierungen mit Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus vergleichen. Die sozialen, politischen und ökonomischen Voraussetzungen sind gänzlich andere. Die Gewalt im Nationalsozialismus war staatlich legitimiert und organisiert. Das Attentat von Hanau hingegen beging ein mutmaßlich auf eigene Faust handelnder Attentäter. Anstatt sich jedoch auf ideologische Kontinuitäten zu beziehen, die zwischen den historischen Nazis und dem Attentäter bestehen, und diese gegebenenfalls anhand verschiedener Beispiele darzulegen, vergleicht er das Attentat von Hanau mit der Invasion und Okkupation der Ukraine 1941 bis 1944. Dies kann quantitativ nur gelingen, wenn dabei auf beiden Seiten von qualitativen Spezifika abstrahiert wird.
Spohr forscht derzeit über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Ihm drängt sich eine Assoziation zur deutschen Okkupation auf. Das ist wegen seines Forschungsschwerpunkts nicht weiter verwunderlich, er sollte es jedoch auch quellenkritisch reflektieren. Dazu gehört die Betrachtung der Vorgeschichte der Besatzung, die Spohr den nicht in osteuropäischer Geschichte geschulten Leserinnen und Lesern vorenthält. Namentlich den polnisch-ukrainischen Krieg und den Anschluss an die Sowjetunion in den frühen zwanziger Jahren sowie den Holodomor, eine von der stalinistischen Politik verursachte Hungerkatastrophe in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der je nach Schätzung zwischen drei und 14 Millionen Menschen zum Opfer fielen, verschweigt er. Wenn Spohr den »Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in der Ukraine«, die er vor allem als Ertragende ohne Handlungsmöglichkeiten darstellt, attestiert, dass sie über die Gewalt der Wehrmacht »nicht mehr überrascht« waren, muss die Ursache dafür auch im historischen Kontext der Zwischenkriegszeit gesehen werden. Die Gewalt der Nationalsozialisten war eine staatlich organisierte. Deutsche Truppen marschierten in ein fremdes Land ein, besetzten es und terrorisierten die Bevölkerung. Die Gemeinsamkeit mit Hanau lässt sich hier allein auf der diskursiven Ebene finden, die Spohr, wie es bei Michel Foucaults Methode der Diskursanalyse üblich ist, verallgemeinert.
Wie dünn diese Argumentation ist, lässt sich auch sprachlich feststellen. Spohr hantiert hier durchaus geschickt mit Verallgemeinerungen (»Kaum jemand kennt«) und suggestiven Fragen (»Wer denkt inzwischen nicht … ?«), die seine Argumentation für Ungeschulte stichfest erscheinen lassen sollen. Seine Beispiele für im gegenwärtigen Diskurs »unbekannte« Orte von Massenerschießungen von Juden und Jüdinnen in der Sowjetunion, die seinem Forschungsschwerpunkt geschuldet ausschließlich in der Ukraine liegen, sind nicht nur äußerst selektiv – Babyn Jar ist mitunter zu bekannt, um es für die eigene Argumentation zu nutzen –, sondern werden nicht unbedingt in ihrer im deutschen Sprachgebrauch üblichen Form verwendet. Natürlich muss man Kamjanez-Podilskyi nicht eindeutschen, aber es ist dennoch fraglich, ob der Name »Kamenez-Podolsk« nicht bekannter wäre. Wieso also nutzt Spohr diese ukrainischen Namen von nicht gänzlich unbekannten ukrainischen Orten? Nur, um einen Vergleich mit den Namen der Hanau-Opfer zu machen, die »ähnlich schwer über die Lippen« gingen. Aus Ähnlichkeiten im Diskurs wird eine historische Gemeinsamkeit konstruiert, die dabei – ohne es zu wollen – zum othering verkommt. Denn Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović und Said Nesar Hashemi sind nicht ausländische Opfer einer deutschen Besatzungsarmee, sondern wuchsen in Deutschland auf. Auch hier ist dies die unzulässige Folge der Aussparung von konkreten historischen Umständen.
Weil eben keine Reflexion der Quellen stattfindet und Assoziationen allein auf Ebene des Diskurses behandelt werden, wird die Aneinanderreihung von vermeintlichen Aktionen und Kontinuitäten nur durch Spohr selbst zusammengehalten. Anstatt die eigene Position als Subjekt innerhalb der Geschichtsschreibung jedoch zu reflektieren, wird sie von ihm mit der oben dargestellten Diskursgaunerei objektiviert. Das Problem der historischen Assoziationen ist nicht, dass sie bei der Narrativbildung behilflich sind, sondern dass sie ein rein subjektives Moment bleiben. Historikerinnen und Historiker müssen davon ausgehend analysieren und forschen – und Belege liefern. Assoziationen sind nur ein Stein des Anstoßes, von dem aus Forschungsfragen nachgegangen werden kann. Historische Assoziationen, wie auch Wut als spontane Reaktion auf die Widerwärtigkeiten der nazistischen Kontinuitäten, haben in der Forschung ihre völlig legitime und mitunter auch gewinnbringende Daseinsberechtigung. Es gilt dabei jedoch, diese Empfindungen gedanklich zu durchdringen, denn wie bereits Theodor W. Adorno schrieb: »Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend: Denken hat die Wut sublimiert.«