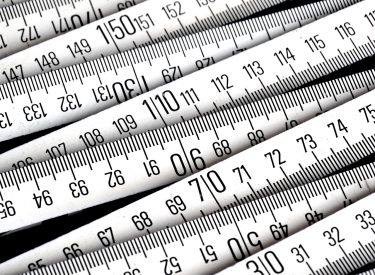Aufklärung muss weh tun
Die Omnipräsenz von sexuellen Belästigungen, Übergriffen und sexueller Gewalt hat spätestens seit dem Hashtag #metoo eine Sichtbarkeit angenommen, die (männliche) Ignoranz vielleicht nicht verhindert, aber erschwert. Dabei ist #metoo wohl vor allem eines: die Widerspiegelung einer Realität, die eigentlich alle kennen müssten, auch wenn sie sie nicht wahrhaben wollen. Wie Bernhard Torsch in Konkret 12/2017 sehr treffend schreibt, ist das »Erschreckendste« an der Kampagne »das Erschrecken« darüber. Das scheinbare männliche Unwissen über das, was der bürgerlich-kapitalistische Alltag für Frauen bedeutet. Die Verdrängungsleistung, die hier zum Ausdruck kommt, ist beeindruckend.
Die Frage, ob #metoo darüber hinaus ein aufklärerisches Moment in sich trägt, bleibt offen und sollte es auch bleiben. Die Kritik von Paulette Gensler, dass es sich bei der Online-Kampagne um nichts als die »bloß quantitative Verwertung« von Einträgen handelt, die, unter einem Schlagwort subsumiert eigentlich von sehr unterschiedlichen Handlungen erzählen, verweist auf ein allgemeines Problem des Begreifens von Gesellschaft und Gewalt, das ist kein Alleinstellungsmerkmal gegenwärtiger feministischer Bewegung. Dass Unterschiede nivelliert werden, liegt in den Verhältnissen selbst begründet und macht auch vor dem Reden über das Leiden an ihnen nicht halt. Eine kritische Reflektion dieser Verhältnisse und der eigenen Verstricktheit darin muss von Feministinnen beständig erkämpft werden. Dass diese Kämpfe, die auf das Ganze zielen, gegenwärtig zu wenig geführt werden, kann nicht oft genug wiederholt werden. Dennoch drückt sich in der millionenfachen Thematisierung der leidvollen Erfahrungen von Frauen ein nicht zu verkennender Unmut aus, diese Realität noch länger ertragen zu müssen. Das sollte und kann nicht mehr ohne weiteres ignoriert werden.
So sammeln sich unter #metoo zwar unterschiedliche Phänomene, die aber auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen sind. Zu Recht wurde von vielen Feministinnen immer auf die Gemeinsamkeit der Erlebnisse verwiesen: »dem Aufwachsen und Leben in einer misogynen Gesellschaft, in der sich Männer immer wieder mittelbar oder unmittelbar Zugriff auf ihre Körper verschaffen wollen« (Paula Irmschler). Objektvierung von Frauen und männliche Verfügungsgewalt über weibliche Sexualität sind in kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaften miteinander vermittelt und reproduzieren sich gegenseitig. Den Verweis auf ein strukturelles Problem trägt #metoo sowohl quantitativ als auch qualitativ durchaus in sich.
Das tieferliegende Problem: Der Verknüpfung von männlicher Sexualität, Macht und Gewalt
Die begriffliche Unterscheidung von sexueller Belästigung, Übergriffigkeit und anderen Formen sexueller Gewalt ist sicherlich notwendig, um zu erkennen, wo es sich um justiziable Verbrechen handelt, die zur Anzeige gebracht werden können (Gensler). Dabei ist auch die Frage wichtig, wer was vor Gericht bringt oder überhaupt bringen kann und wer nicht, was davon abhält, jemanden anzuzeigen. Gleichzeitig sind diese unterschiedlichen Formen sexueller Belästigung und Gewalt jenseits der Möglichkeit ihrer juristischen Verurteilung miteinander verbunden, oft gehen einer sexuellen Straftat andere Formen gewalttätiger Handlungen voraus (Irmschler). Denn so verschieden die Formen auch sein mögen, hängen sie doch mit einem tieferliegendem Problem zusammen: Der Verknüpfung von männlicher Sexualität, Macht und Gewalt. Dabei kann das eine nicht auf das andere reduziert werden. Sexuelle Übergriffigkeit und Gewalt ausschließlich als reine Machtausübung zu begreifen, die mit der Sexualität eigentlich nichts zu tun habe, scheint das Problem nicht ganz fassen zu können. Ebenso wenig kann die Neigung zu sexueller Gewalttätigkeit als eine »Naturtatsache« verklärt werden, die in der biologischen Ausstattung der Mannes verankert und als solche unveränderbar ist, weil die Triebe nun mal so stark seien.
Die entscheidende Frage zielt auf die eklatante Verwobenheit von männlicher Sexualität mit Aggressionen und Gewalt. Es wäre fatal, außer Betracht zu lassen, dass es sich dabei um ein Grundproblem männlicher Sexualität und ihrer Konstitution in den herrschenden Verhältnissen handelt. Der alleinige Verweis auf männliche Machtstrukturen reicht nicht aus, er bleibt zu abstrakt. Man muss in den Blick nehmen, wie sich diese durch das männliche Subjekt hindurch bewegen, verfestigen und neu hervorbringen. Man kommt an der Psyche nicht vorbei, um die Reproduktion von Herrschaft zu begreifen. Aufklärung muss auch dorthin, wo es weh tut und konkret wird. Dort, wo Angst und Abwehr eine wichtige Rolle spielen und der Erkenntnis oft zuwiderlaufen.
Rolf Pohl: die Verwobenheit männlicher Sexualität und Aggression
Sozialpsychologischer und psychoanalytischer Theorie ist das bekannt: Mit einem kritischen Rekurs auf die Triebtheorie von Freud, beschreibt der Sozialpsychologe Rolf Pohl in »Feinbild Frau. Männliche Sexualität, Gewalt und Abwehr des Weiblichen« (2004), dass sexueller Gewalt eine ambivalente bis feindselige Einstellung gegenüber Frauen zugrunde liegt, die tendenziell bei sehr vielen Männern in hegemonial männlichen Gesellschaften zu finden ist. In seiner grundlegenden These von der Verwobenheit männlicher Sexualität und Aggression, hängt diese mit einer Abwehr des Weiblichen zusammen. Weiblichkeit und deren Imagination wird vom männlichen Subjekt als Bedrohung wahrgenommen, weil sie dessen eigene Verletzlichkeit und Abhängigkeit von ihr birgt.
Nach Pohl entspannt sich das grundlegende Dilemma männlicher Subjekte und ihrer Sexualität um die Pole Autonomie und Abhängigkeit: Wo Autonomie imaginiert wird und die kulturell-symbolische Aufladung von Männlichkeit sich darüber bestimmt, niemanden zu brauchen und sich selbst vollkommen zu genügen, bricht diese vermeintliche Omnipotenz am ehesten an der Sexualität. Denn Lust und Begehren brauchen ein Objekt (in heterosexuell dominierten Gesellschaften oft die Frau), um sich selbst hervorzubringen und um Befriedigung zu erlangen. Der Autonomiefantasie werden also gerade durch das Begehren und die eigene Sexualität Grenzen gesetzt. Diese Grenzen sind verbunden mit Verlust von Kontrolle und Macht, mit Verletzbarkeit und Angst. Emotionen, die der Männlichkeit zu schaffen machen und die sich besser, abgespalten von ihr, auf die Frau projizieren lassen
Dieser dem »Männlichkeitsdilemma zugrunde liegende Widerspruch führt zu Angst, Abwehr und Projektionen. Oder zu einer Transformation der Angst in Aggressionen. Aggressivität kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn eine Bedrohung der eigenen Integrität und Identität aufscheint. Im Umgang mit diesen Bedrohungen und der dadurch ausgelösten bzw. sowieso vorhandenen narzisstischen Kränkung, zeigt sich eine Neigung zur psychischen Regression, dem Rückgriff auf frühere psychische Spaltungsmechanismen im Subjekt. Das Frauenbild wird aufgespalten, die Frau wird zum Objekt der Begierde und zum Objekt des Hasses zugleich. Dass sie aber selbst ein Subjekt ist, das ist der Riss im männlichen Weltbild, die verwehrte Macht und damit die narzisstische Kränkung.
Eine solche Männlichkeit steht unter ständiger Bedrohung und trägt den eigenen Verlust mit sich herum. Nicht nur in den Diskursen von Männerrechtlern wird dieser Verlust als »Krise der Männlichkeit« projektiv aufgeladen. Die größte Bedrohung scheint hier von Frauen auszugehen, die die vermeintlichen Bedürfnisse von Männern nach Stärke und Kontrolle negieren und sie so zu »Schwächlingen« verkommen lassen. In der sexistisch-rassistischen Wendung tragen dann ebendiese Frauen die Schuld daran, dass autochthone Männer nicht mehr als Beschützer vor der sexuellen Potenz und Übergriffigkeit des vermeintlich Fremden auftreten können. Das psychische Dilemma in der männlichen Subjektkonstitution bedarf einer beständigen Verdrängungsleistung, die zur Abspaltung und Abwehr eigener konflikt- und angstbesetzter Anteile und ihrer Projektion auf Frauen oder »Fremde« führt.
Das Männlichkeitsdilemma
Warum der Konflikt des Männlichkeitsdilemmas sich seiner Bewusstwerdung und damit auch der Möglichkeit seiner Aufklärung fortwährend entzieht, ist nur durch die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären, die ihn beständig hervorbringen. Diese anzugreifen muss das Ziel feministischer Bewegungen sein. Die Frage nach den Ursachen für sexuelle Gewalt trägt die Frage nach dem Geschlechterverhältnis genauso in sich, wie die Frage nach den Bedingungen für Befreiung überhaupt. Feminismus darf dabei nicht missverstanden werden als ein Partikularinteresse von Frauen, sondern, dieses eingeschlossen, zielt Feminismus auf den Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes Wesen ist. Dieser Umsturz bedarf der Aufklärung über die gesellschaftliche Realität, eine Aufklärung, die den Frieden mit den Verhältnissen nicht schließen kann. Dafür braucht es psychoanalytische Kategorien, denn die Auseinandersetzung über einen gesellschaftlichen Zustand ist am Ende auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Es bleibt zu hoffen, dass das der Kampf gegen sexuelle Gewalt nicht als der alleinige Kampf von Frauen missverstanden wird, sondern auch als ein Kampf von Männern gegen ihre Männlichkeit.