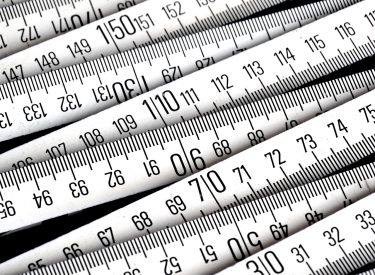Viele falsche Freundinnen machen noch keinen Feminismus
»Pornos sind Hassrede.« Das erinnert an Andrea Dworkin und Catharine MacKinnon, die in den achtziger Jahren zu den »Feminist Sex Wars« aufriefen und sich erbitterte Diskussionen etwa mit Linda Williams lieferten, der feministischen Filmwissenschaftlerin und Begründerin der porn studies, oder mit Nadine Strossen, die in ihrem Buch zur Verteidigung der Pornographie aufrief. In Deutschland war es Alice Schwarzer, die 1987 die »PorNO-Kampagne« initiierte und in Dutzenden leidenschaftlichen Artikeln in der von ihr mitbegründeten Zeitschrift Emma erklärte, dass »Pornos die Theorie, Vergewaltigung die Praxis« seien. Inzwischen, so könnte man meinen, gibt es genügend Beweise dafür, dass sich Pornographie und Feminismus nicht ausschließen müssen. Die Filme von Erika Lust etwa stellen das Begehren und den Blick heterosexueller Frauen in den Mittelpunkt, Pornos von Lesben und Queers, die für Lesben und Queers gemacht sind, haben es noch nicht in den Mainstream, aber durchaus auf den Markt geschafft, und seit 2006 werden jährlich die »Feminist Porn Awards« abgehalten.
Nun stammt allerdings die eingangs zitierte Überschrift aus einem Artikel des Blogs »Die Störenfriedas«, der Anfang Februar erschien. Wer als aufgeklärte Feministin dachte, der Differenzfeminismus sei inzwischen reflektierter geworden, seine antiquierte Prostitutionsfeindlichkeit und der Ausschluss von Transsexuellen gehörten der Vergangenheit an, wird bitter enttäuscht.
In einem weiteren Artikel mit dem Titel: »Die Sache mit den Safe Spaces – Warum ich keine Schwänze auf Frauentoiletten haben will« verkündet die Verfasserin, nicht operierte transsexuelle Frauen auf Damentoiletten seien für sie eine Bedrohung. Dass »Sex« und »Gender« nicht zwingend übereinstimmen müssen, scheint in der Schreibstube der Bloggerin nicht angekommen zu sein: »Sorry, es gibt sowas wie Biologie, das sind FAKTEN, die wir nicht einfach wegwischen können«, poltert sie. Dass es, würde man einer transsexuellen Frau zumuten, an einer Pinkelrinne zu stehen, mindestens zu aggressiven Sprüchen und häufig zu physischen Gewalttaten kommen würde, scheint der Autorin genauso egal zu sein wie die Antiquiertheit ihrer Thesen: »Ja also sorry, aber ist das mein Problem?«
Delegitimiert der essentialistische Feminismus alle Identitäten und Begehren abseits der zweigeschlechtlichen Norm, sucht man auf der anderen Seite verzweifelt nach immer neuen.
Nach heftiger Kritik an dem Artikel bemüßigten sich die Autorinnen des Blogs einer Antwort. Statt Einsicht zu zeigen, dass die Erfahrungen und Kämpfe von cis- und transsexuellen Frauen zwar nicht immer die gleichen sind, sich aber auch nicht ausschließen müssen, da wir alle von den alltäglichen Zurichtungen patriarchaler Strukturen betroffen sind, diskreditierte man die Kritikerinnen, reproduzierte Transmisogynie und stilisierte sich selbst zum Opfer einer queeren Hetzkampagne.
Von einem Mob aus bösen Queerfeministinnen verfolgt sieht sich auch das Zentralorgan des »Zweite-Welle-Feminismus«, die gute, alte Emma. In ähnlich hämischem Tonfall, wie ihn die Kolleginnen der »Störenfriedas« an den Tag legen, macht man sich hier über die »hippe, coole« Welt der »Hetzfeministinnen« und deren Freundinnen lustig. Höhnisch lässt man sich über Triggerwarnungen oder den Wunsch nach Inklusion von Women of Color aus, die Sexarbeiterinnengewerkschaft Hydra wird als »Pro-Prostitutions-Lobby« bezeichnet und man salbadert im Jargon der Neuen Rechten vom »Terror dieser Politisch Korrekten«.
Die Redaktion der Emma hat jedoch in einigen Punkten durchaus recht. Anders als beim schlechten Abklatsch, den Störenfriedas, handelt es sich bei den Redakteurinnen immerhin um theoretisch versierte Feministinnen, die die Notwendigkeit eines objektiven Wahrheitsanspruches auch abstrakt artikulieren können. Dies zeigt sich vor allem, wenn betont wird, eine Kritik an patriarchaler Unterdrückung im Islam sei unumgänglich, oder wenn das Verhältnis von Kapitalismus und männlicher Hegemonie thematisiert wird.
Dies wird umso deutlicher, wenn man sich die andere Seite der unrühmlichen Medaille anschaut, die sich »zeitgenössischer deutscher Feminismus« nennt. Von den Gegnerinnen und Gegnern »postmoderner Beliebigkeit« werden oft überzeichnete Schreckenszenarien aufgestellt, die queere Schreibweisen oder Identitätsvorstellungen parodieren. In der queeren Postille Queerulant*in findet man die Vorlagen dazu in unironischer Ernsthaftigkeit. Das sich selbst schon im Namen infantilisierende Blog »Mädchenmannschaft« oder das Missy Magazine können im Vergleich zu Queerulant*in als Hort der Aufklärung gelten. An dieser Stelle sei in Erinnerung gerufen, dass ein Artikel im Missy Magazine das Tragen des Hijab zum emanzipatorischen Akt stilisierte und die Critical-Whiteness-Modebloggerin und Kufiya-Apologetin Hengameh Yaghoobifarah zu den dortigen Redakteurinnen zählt. Generell hat der Queerfeminismus starke antisemitische Tendenzen, die von theoretischen Vorbildern wie Judith Butler oder Jasbir Puar vorgegeben werden. Man identifiziert und solidarisiert sich mit den Unterdrückten, da passen die als solche imaginierten Palästinenserinnen und Palästinenser gut rein, und dass Araberinnen und Araber in Israel im Gegensatz zu den arabischen Ländern für das Ausleben ihrer Homosexualität nicht ausgepeitscht oder aufgehängt werden, wird mit dem Slogan des »Pinkwashing« diffamiert.
Delegitimiert der essentialistische Feminismus alle Identitäten und Begehren, die abseits einer zweigeschlechtlichen Norm stehen, sucht man auf der anderen Seite verzweifelt nach immer neuen. Anderssein wird zu einer erstrebenswerten Norm erhoben. Wer nicht von realen Unterdrückungsmechanismen gegen LGBTQ betroffen ist, dem genügt es nicht, sich darüber zu freuen, nicht, sich mit von Homo- oder Transphobie betroffenen Freundinnen und Freunden zu solidarisieren, sondern er oder sie findet neue Formen von Begehren. »Demisexualität« ist eine davon. Sie bezeichnet, sich nur zu Personen sexuell hingezogen zu fühlen, zu denen man eine tiefe emotionale Bindung verspürt. Eine andere ist »Grey-Asexualität«, was bedeutet, manchmal sexuell zu begehren, manchmal aber auch nicht. Einher geht damit die Forderung, etwas wie »Demisexualität« in die LGBTQ-Reihe mit aufzunehmen, weil es sich hierbei auch um eine vom heteronormativen Status quo deviante und unterdrückte Sexualität handele. Weitere Identitätsformen, über die geschrieben wird, sind »Guydykes« und »Girlfags«, also Cismänner, die sich als lesbische Frauen, und Cisfrauen, die sich als schwule Männer identifizieren. Jede lesbische Frau, die sich Sprüche wie »Ich bin auch eine Lesbe, nur in einem Männerkörper« anhören musste, ist geneigt, hier seufzend mit den Augen zu rollen. Girlfags und Guydykes seien ihre Identitäten gegönnt. Sobald die Autorin eines Textes allerdings über schwule Männer zu lobhudeln beginnt und sich über Mangas mit schwulen Liebesbeziehungen freut (Queerulant*in, Ausgabe 9), macht dies mehr den Eindruck einer Fetischisierung als der ernsthaften Anerkennung schwuler Lebensrealitäten.
Im Großteil der Berichte in queeren Medien vermisst man schmerzlich eine Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse. Dies mag auch der Form geschuldet sein: Man liest hauptsächlich Erfahrungsberichte von Einzelpersonen. Eine Abstraktion vom Besonderen hin zum Allgemeinen sucht man vergeblich, demzufolge bleibt auch die theoretische Auseinandersetzung auf der Strecke. Feministische Arbeit kann nun einmal nicht stattfinden, ohne die Ideologie von patriarchal strukturiertem Kapitalismus zu beachten.
Ein weiteres Problem in der queerfeministischen Szene ist die Annahme, dass das Sprechen über eine Diskriminierungserfahrung automatisch die andere Diskriminierungserfahrung ausschließe. Will man bei den »Störenfriedas« transsexuellen Frauen den Zugang zur Damentoilette verwehren, möchten Ladyfest-Gruppen das Backen von Vulva-Cupcakes unterbinden, weil diese Transpersonen triggern könnten. Das Sprechen über weibliche Genitalien oder die Menstruation wird kritisiert, da es trans-exkludierend sei. Man fühlt sich in Zeiten zurückversetzt, als die Menstruation etwas Ekliges, Verbotenes war, über das geschwiegen werden muss. Dies behindert feministische Aufklärung, die an der Normalisierung und Entmystifizierung des weiblichen Körpers arbeitet, immens.
Es ist schwer, hierzu einen adäquaten Lösungsansatz zu finden, außer Kritik zu üben und beiden Seiten aufzuzeigen, wo und warum sie falsch liegen. Aber eines ist sicher: Der Feminismus muss vor seinen falschen Freundinnen verteidigt werden, und weder Transphobie noch Antisemitismus haben in einem aufgeklärten, ideologiekritischen Feminismus irgendetwas verloren.