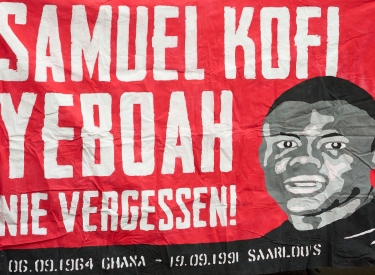Terror und Hysterie
Die Grünen und »Die Linke« fordern den Rücktritt des Verteidigungsministers, die SPD spricht von einem »wild gewordenen Minister«, und der Fraktionsvorsitzende der Union, Volker Kauder, verlässt aus Protest gegen die Rede des Fachmanns für Innenpolitik der SPD, Fritz Rudolf Körper, die Bundestagssitzung. Ursache des Streits sind die Terrorszenarien der CDU und ihre Vorschläge, wie in solchen Situationen zu handeln ist. Vor allem die Absicht des Verteidigungsministers Franz-Josef Jung, im Falle eines terroristischen Angriffs mit Passagierflugzeugen die Insassen dem Allgemeinwohl zu opfern, sorgt für Aufregung.
Dabei ist diese Idee gar nichts Neues, und bei näherem Hinsehen entpuppt sich die öffentliche Empörung mancher Politiker als peinliche politische Farce. »Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist.« Dies ist der Wortlaut von Artikel 14, Absatz 3 des Luftsicherheitsgesetzes, das von der rot-grünen Bundesregierung im Juni 2004 beschlossen wurde. Faktisch wurde damit das präventive Töten Unschuldiger erlaubt.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte den Absatz im Februar 2006 für verfassungswidrig, da er mit dem Recht auf Leben und der Garantie der Menschenwürde nicht vereinbar sei. Christian Ströbele (Grüne) zeigte sich damals erfreut über die Entscheidung und sagte während einer Bundestagssitzung, er habe dem Gesetz sowieso nur zugestimmt, um zu verhindern, dass »in einer Großen Koalition ein Kompromiss herausgekommen wäre, der einen zusätzlichen Einsatz der Bundeswehr im Inneren möglich gemacht hätte«. Tatsächlich aber war Ströbele persönlich an der Ausarbeitung des verfassungswidrigen Absatzes beteiligt gewesen.
Umso peinlicher ist es, wenn Ströbele Jung wegen der gleichen Sache als »Gefahr nicht nur für die Truppe, sondern für die Sicherheit in der Bundesrepublik« bezeichnet und populistisch verkündet: »Wir sind alle Passagiere.« Das Gleiche gilt für die Teilnahme der Grünen und der Mitglieder der Partei Die Linke an der Großdemonstration »Freiheit statt Angst« am Wochenende in Berlin. Ein Teil der im Aufruf kritisierten Maßnahmen wurde nämlich von eben diesen Parteien zuvor durchgesetzt. Rot-Grün verdanken wir die biometrischen Daten in Pässen und Aufenthaltspapieren, ebenso den Zugriff des BND und des Verfassungsschutzes auf die Daten der Asylbewerber. Auch die Erweiterung des so genannten Anti-Terror-Paragraphen auf ausländische Organisationen mit dem Paragraphen 129b wurde von ihnen beschlossen. Die Linkspartei führte ziemlich genau ein Jahr vor dem Gipfeltreffen in Heiligendamm gemeinsam mit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem die Videoüberwachung des öffentlichen Raums, die automatische Erfassung von Autokennzeichen und die »präventive« Telefonüberwachung ein.
Warum haben die Parteien, die in der Opposition am lautesten die Freiheit verteidigen, offensichtlich keine Probleme damit, sie einzuschränken, wenn sie selbst regieren? Der Vorwurf, es ginge ihnen nur um die Sicherung ihrer Macht, sei es durch größere Kontrolle oder durch Kompromisse mit dem Koalitionspartner, greift zu kurz. Das Problem liegt woanders.
Keine Regierung ist sonderlich erpicht darauf, dass in ihrer Legislaturperiode ein Anschlag verübt wird. Überwachungsmaßnahmen und Sicherheitsgesetze, die von Grünen, Linkspartei und FDP gleichermaßen mitgetragen werden, wenn sie mitregieren, sind Zeichen für ihre Hilflosigkeit gegenüber der realen Gefahr des islamistischen Terrors.
Für die Parteien in der Opposition ist es immer einfach, Vorschläge zu kritisieren und abzulehnen, weil sie nicht in der Verantwortung stehen. Bei verhinderten Anschlägen, wie zuletzt bei der Festnahme der drei mutmaßlichen Terroristen in Ulm, heißt es, »dass die bisher existierenden Mittel ausreichend waren«. So sagte es etwa Renate Künast, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, nach den Festnahmen. Kann ein Anschlag nicht verhindert werden, fühlt man sich in der Ansicht bestätigt, dass die stärkere Überwachung nichts genutzt habe.
Die Diskussion um Sicherheit und die Maßnahmen gegen den Terror erschöpft sich auf Seiten der parlamentarischen Kritiker darin, die Vorschläge der anderen abzulehnen und allenfalls noch so zu tun, als habe man selbst die Lösung parat. Die Papiere der Grünen und der FDP zur Terrorismusbekämpfung bestehen fast ausschließlich aus Forderungen, wie man es nicht machen sollte. »Die Linke« verzichtet auf ein solches Papier und weigert sich, die ideologische Besonderheit des Islamismus anzuerkennen. Für den Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine ist »ein Muslim, der Bomben wirft«, genauso Terrorist wie »Bush, Blair und viele andere, die völkerrechtswidrige Kriege zu verantworten haben«. Dementsprechend ist ein Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan für »Die Linke« das beste Mittel der Terrorismusbekämpfung, denn »die erhöhte Terrorgefahr hierzulande ist Folge dieses Krieges«, wie auf ihrer Internetseite erklärt wird.
Die Suche nach konstruktiven Vorschlägen der Parteien, die die konkrete Gefahr islamistischer Anschläge anerkennen und trotzdem einen Abbau persönlicher Freiheiten nicht vorantreiben, bleibt meist erfolglos. Eine Kritik an der geplanten Institutionalisierung des Notstands ist noch das Beste, was in der gegenwärtigen Diskussion zu vernehmen ist. Und sie besitzt ihre Berechtigung.
Dass ein Verteidigungsminister einen eindeutigen Verfassungsbruch fordert, ist untragbar. Wenn Innenminister Wolfgang Schäuble in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor nuklearen Terroranschlägen warnt und gleichzeitig sagt, man solle sich aber bitte deswegen nicht in »Weltuntergangsstimmung« versetzen lassen, oder der bayerische Innenminister Günther Beckstein schon mit Sprengstoff beladene Schiffe auf Kiel und Rostock zukommen sieht, kritisiert Außenminister Frank-Walter Steinmeier dies zu Recht als parteipolitisches Kalkül, um »die Ängste der Menschen täglich neu zu mobilisieren«. Angst zu verbreiten war schon immer ein gut funktionierendes Herrschaftsinstrument.
Der von der CDU und der CSU geforderte Einsatz der Bundeswehr im Inneren »im Fall der Abwehr von Angriffen, die auf die Beseitigung des Gemeinwesens und die Vernichtung der staatlichen Rechts- und Freiheitsordnung gerichtet sind« (Schäuble), lässt sich problemlos auf alle potenziellen Staatsfeinde übertragen. Nicht ohne Grund hatte die Bundeswehr bereits vor dem Gipfel in Heiligendamm geübt, wie man mit Demonstranten umzugehen hat.
Wegen der schwammigen Definition von Terrorismus werden die Maßnahmen gegen den Terror stets auch gegen die radikale Opposition verwendet werden können. Die Grünen kritisieren diesen Aspekt, obwohl gerade sie diese Möglichkeiten mit der Einführung des Paragraphen 129b stark erweitert haben. Das aber wollen sie nicht sehen: »Im Unterschied zur besonnenen Ausweitung bestimmter Befugnisse unter Rot-Grün als Reaktion auf neue Gefahren ist hier die Terrorgefahr nur Vorwand«, sagte Wolfgang Wieland, der Sprecher für innere Sicherheit bei den Grünen, im Hinblick auf geplante Maßnahmen der Großen Koalition.
Dass sich Linke in ihrer Kritik auf die angebliche »Terrorhysterie« konzentrieren, ist problematisch. Dadurch werden nicht die Gesetzesverschärfungen an sich, sondern es wird lediglich ihre derzeitige Berechtigung in Frage gestellt. Im Falle eines geglückten Anschlags wäre diese Kritik obsolet und den Sicherheitsfanatikern das Feld überlassen.



 Mit gelöster Bremse
Mit gelöster Bremse