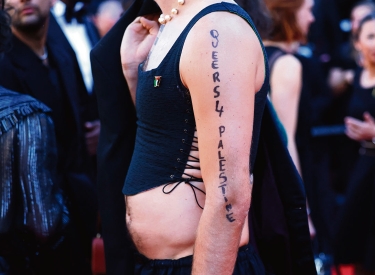Der Tortilla-Alarm
Schon 1998 war für Samuel P. Huntington klar, wo das alles enden werde. In diesem Jahr setzte sich »José« gegen »Michael« als beliebtester Name für Neugeborene in Kalifornien und Texas durch, schreibt der US-amerikanische Politikwissenschaftler. Stück für Stück würden sich die Mexikaner nun zurückholen, was ihnen die Nachbarn aus dem Norden in zwei Kriegen im 19. Jahrhundert abgenommen haben.
»Die mexikanische Migration provoziert eine demografische Reconquista«, meint Huntington. Diese schleichende soziokulturelle Rückeroberung zerstöre die »angelsächsisch-protestantische und weiße Identität« der Vereinigten Staaten. Denn die Mexikaner wollen sich nicht assimilieren und kein Englisch reden, sie kommen massenweise, sind nicht ehrgeizig und vermehren sich obendrein wie die Karnickel. Über kurz oder lang zerfallen die USA in zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Sprachen. Spätestens im Jahr 2080 werden die Südstaaten gemeinsam mit den nördlichen mexikanischen Bundesländern »Amexica«, »MexAmérica« oder »Mexifornia« gründen.
Huntingtons neueste Kampfschrift »Who Are We?« erscheint in diesen Tagen. Sein in der letzten Nummer des US-amerikanischen Magazins Foreign Policy veröffentlichter Artikel mit dem Titel »Die hispanische Herausforderung« fasste bereits die wesentlichen Thesen zusammen und sorgte unter Mexikos Intellektuellen für erhebliche Empörung. Die Linke hat dem Text bislang wenig Beachtung geschenkt, doch in liberalen Kreisen wurde die Fortsetzung von Huntingtons Vision vom »Clash of Civilizations« heftig diskutiert. Jetzt sucht er das bedrohliche Andere nicht mehr fernab in islamischen Welten, wie in seinem 1996 erschienenen »Kampf der Kulturen«. Jetzt geht’s gegen den inneren Feind: die lateinamerikanischen, insbesondere die mexikanischen Migranten und Migrantinnen.
Und damit wird die Sache auch zu einer innenpolitischen Angelegenheit Mexikos. Jeder fünfte Mexikaner lebt jenseits des Rio Grande, kaum eine Familie hat nicht Verwandte im reichen Norden. Die Zahlungen der etwa 25 Millionen Abgewanderten an ihre Angehörigen in der alten Heimat sind die zweitwichtigste Devisenquelle Mexikos. Kein Politiker kommt also an den Sorgen und Interessen der Migranten und ihrer Angehörigen vorbei.
Dabei haben viele der Ausgewanderten genau das Gegenteil dessen getan, was ihnen Huntington vorwirft. Sie haben sich samt Tortillas und Jungfrau Guadalupe mitten in San Francisco oder in Missouri niedergelassen und Firmen und Familien gegründet. Trotzdem hat jede Fahrt in die alte Heimat ihre besondere Bedeutung. Sie wird zum Schaulauf des Erfolgs oder zum Ausdruck des Scheiterns. Markenklamotten, Autos oder Musikanlagen manifestieren die höhere soziale Stellung gegenüber denjenigen im Dorf, die sich noch immer unter Lebensgefahr illegal über die Grenze schleichen müssen, um für ein paar Dollar auf kalifornischen Feldern zu arbeiten. Das Leben in »Gringolandia« bestimmt also auch den Alltag in der Sierra. Und andersrum. »Amexica« ist längst Wirklichkeit in der Provinz der mexikanischen Bundesstaaten Michoacán, Oaxaca oder Guerrero und in den Chicano-Barrios von Los Angeles oder Atlanta. Mit Huntingtons halluziniertem Staatsgebilde hat dies freilich nichts zu tun.
»Absurd« findet der Historiker und Publizist Enrique Krauze deshalb die Behauptung von der drohenden »Reconquista«. Nie habe jemand das im texanischen Befreiungskrieg und im mexikanisch-amerikanischen Krieg verlorene Gebiet eingeklagt. Im Gegenteil: Zumindest bis 1927 habe man wegen der mexikanischen Revolution eine »neue Yankee-Invasion« befürchtet. Krauze ist Herausgeber der Letras Libres, einer monatlich in Mexiko-Stadt erscheinenden Zeitschrift, die aus einer Gruppe um den mittlerweile verstorbenen Schriftsteller Octavio Paz hervorgegangen ist. Das liberale Blatt beschäftigt sich regelmäßig mit dem komplexen Verhältnis zwischen Mexiko und den USA. Ihre aktuelle Ausgabe hat Letras Libres dem umstrittenen Essay gewidmet. Mexiko habe durch die »mestizaje«, die Vermischung von Spaniern und Indigenen, reichhaltige Erfahrung, die »beachtliche Ergebnisse des Zusammenlebens« hervorgebracht hätten. »Huntingtons Obsession, Identitäten zu bewahren«, münde dagegen »in der Idee der rassischen Reinheit«, resümiert Krauze und bezeichnet den Politikwissenschaftler als »Identitätsfanatiker«.
Tatsächlich will Huntington »tiefgründige Unterschiede zwischen mexikanischen und US-amerikanischen Werten und Kulturen« ausfindig gemacht haben, die der anglosächsisch-protestantischen Welt den Garaus machen könnten.Dann wartet er mit Zahlen auf: 58 Prozent der illegal in den Vereinigten Staaten Lebenden seien Mexikaner, 90 Prozent der Hispanos sprächen in der Familie spanisch usw.
Doch obwohl Huntingtons »pseudo-akademischer fremdenfeindlicher Blödsinn« jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, wie der Kolumnist Andrés Oppenheimer im Miami Herald bestätigt, machte sich eine Reihe Intellektueller daran, Zahlen gegen Zahlen zu setzen. So etwa der Schriftsteller Carlos Fuentes. Er nannte den US-Amerikaner zwar einen »versteckten Rassisten«, einen »Quasi-Faschisten«, doch dann stieg er in den von Huntington eröffneten Diskurs ein. »In der zweiten oder dritten Generation sind 55 Prozent der Hispanos Besitzer eines eigenen Hauses, verglichen mit 71 Prozent weißer und 44 Prozent schwarzer Haushalte«, versuchte der mexikanische Schriftsteller klarzustellen, dass auch Latinos in den USA erfolgreich schuften können. Fuentes bestätigte damit schon fast die Befürchtung des Direktors des Washingtoner Instituts für Migrationspolitik, Dimitri Papademetriou. »Wer zuerst erscheint, gewinnt die politische Diskussion«, sagte Papademetriou der mexikanischen Tageszeitung Universal. Er befürchtet, dass man sich deshalb mit Huntingtons Position wohl während der nächsten drei bis vier Jahre herumschlagen müsse.
Woher kommt die Angst vor einer mexikanischen »Spezies des Jihad« gegen die vermeintlich überlegenen westlichen Werte, fragt der Historiker Lorenzo Meyer in der konservativen Tageszeitung Reforma, wo doch der US-amerikanische Politologe Francis Fukuyama schon nach dem Zusammenbruch des Sozialismus euphorisch das »Ende der Geschichte« erklärt habe. Meyer sucht die Erklärung in Huntingtons außenpolitischer Position. Schon im »Kampf der Kulturen« habe er eine Isolierung der USA propagiert, um die »ökonomische, militärische und politische Überlegenheit« zu erhalten. »Aus dieser Perspektive ist der Multikulturalismus für jede Zivilisation ein Gift und eine Gemeinde von Latinos im Herzen des Imperiums eine kulturelle Gefahr«, folgert der Historiker. Nach Ansicht des Publizisten Krauze sieht sich Huntington nach der Bestätigung seiner Kulturkampf-Thesen durch den 11. September 2001 als »prophetischer Warner vor dem äußeren Feind« offenbar gestärkt, um nun nach dem inneren Feind Ausschau zu halten.
Damit wird Huntigton zweifellos ein großes Publikum finden. Dass US-Präsident George W. Bush seine wöchentlichen Radioansprachen mittlerweile auf Englisch und Spanisch eröffnet und vor wenigen Monaten mit einem Vorschlag zur Reform des Einwanderungssystems um Latino-Wählerstimmen buhlte, kommt beim rassistischen Teil der Bevölkerung schlecht an. Huntingtons »Warnung«, ein »weißer Nationalismus« könne »die nächste logische Stufe der Identitätspolitik Amerikas« sein, dürfe seine Adressaten also nicht verfehlen. Schon jetzt gehen bewaffnete rechtsradikale Bürgerwehrtruppen an der Grenze zu Mexiko auf Migrantenjagd.