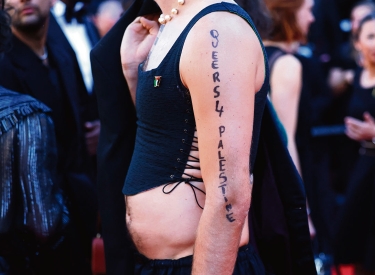Das große Eszett
Seine Eltern sind tüchtige, aufwärts strebende Kleinbürger und Familienmenschen. Man schreibt die sechziger Jahre, als Martin Schlosser geboren wird, der uns die Geschichte davon erzählt, wie es zuging bei ihm zuhause, am deutschen Eck.
Man tritt eine Reise mit ihm an in ein längst vergessenes Land vor unserer Zeit, in dem es nur zwei Fernsehprogramme und drei Parteien gab und dieses Land Bundesrepublik Deutschland hieß.
In diesem Land hat man so eigenartige Dinge wie einen Hobbyraum, und der Alltag in der Provinz ist irgendwie anheimelnd und rührend. Martin spielt mit seinen Geschwistern, liest, tobt herum, begibt sich auf Streifzüge durch die dörfliche Umgebung, erkundet die kleinbürgerliche Welt seiner Eltern und Großeltern. Und er sieht fern. Das tut er am liebsten.
Es gibt gutes und schlechtes Fernsehen, und Martin kann wohl als Experte darin gelten, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Gutes Fernsehen heißt »Daktari«, »Bonanza«, »Lassies Abenteuer«, »Pan Tau«, »Bezaubernde Jeannie«, »Pippi Langstrumpf«, »Schweinchen Dick«, »Raumschiff Enterprise«, »Die Leute von der Shiloh Ranch« und »Flipper«. Schlechtes Fernsehen sind die »sechs Siebeng’scheiten«, »Teletechnikum«, »Schaukelstuhl« und »Mosaik«. »Um das aus freien Stücken zu kucken, musste man mit einem Bein im Grab stehen.«
Und wenn man beim guten Fernsehen aufpasst, kann man sogar fürs spätere Dasein als Erwachsener etwas lernen. Zumindest begreift man schnell, was lustig ist und was öde: »Ich wollte lieber Old Shatterhand sein, weil der auch mal kämpfte und schoss. Winnetou ritt immer nur von einem Stamm zum andern, um Frieden zu stiften.«
Selbst im Fernsehen aber, der Welt, in der man als Kind leben will und die eigentlich die richtige ist, gibt es Dinge, die einem Rätsel aufgeben, zum Beispiel dieses unwirkliche Knallen, das in Westernfilmen stets synchron zu den Fausthieben erklingt. Hören sich Kinnhaken tatsächlich so an? Mama erklärt also bereitwillig und taktvoll ihrem Jungen, dass es sich anders verhält: »Mama sagte, die Geräusche kämen davon, dass einer mit der Peitsche auf tote Schweine haut.« Es ist wichtig, seinen Kindern alles rechtzeitig zu erklären.
Erstaunliche Ungereimtheiten und eklatante Widersprüche gibt es auch in der Werbung, in der seinerzeit noch so wundersame Existenzen wie das Lenorgewissen, der Gilb, das HB-Männchen, der Bärenmarkebär und der Grauschleier ihr Dasein fristen : »Ceh, ah, eff, eff, eh, eh, trink nicht so viel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Der Tchibo-Experte in der Reklame war aber dick und fett.« Und manches hat sich bis heute nicht geändert, sondern als ewig gültige Wahrheit herausgestellt: »Absolute Scheiße war das Neujahrs-Skispringen im Fernsehen.«
Neben dem Fernsehen gibt es noch die Schule. »Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam.« Dort hat man zu jener Zeit einen Füller von Geha oder einen von Pelikan, und immer gibt es einen Mitschüler, der die kleinen Kugeln aus den verbrauchten Tintenpatronen sammelt.
Bereits im zarten Grundschulalter stellt sich heraus, dass nicht nur das Fernsehen, sondern sowohl die Eltern wie die Lehrer darauf aus sind, einen zu belügen und zu betrügen, und dass die Welt unvollkommen ist: »Wie wohl das große Eszett (…) aussah. (…) Ich fragte Frau Kahlfuß danach, und sie sagte, das gebe es nicht. Es gebe nur das kleine Eszett. Das war der größte Beschiss, den die Welt je erlebt hatte.« Andere Enttäuschungen werden noch folgen.
Auch später, als Martin das Gymnasium besucht, hat er erstaunlicherweise genau dieselben Lehrer, die auch wir hatten, im Fach Religion eine »ondulierte Gewitterziege«, in Mathematik einen »fetten alten Saftsack«. Von ihm wird man dazu genötigt, einen Haufen Schwachsinn zu lernen, den man nie wieder braucht im Leben. »Die Kreuzmengenbildung ist bezüglich der Vereinigung distributiv.«
Außer Eltern, Geschwistern, Fernsehen und Schule sind da noch die Mädchen. Sie sind schwer benachteiligt: »Zum Geburtstag kriegte Renate Ringe, Taschentücher und Parfüm und solchen Kack. Mädchen waren schon arme Schweine.«
Darüber hinaus stimmt mit ihnen offenbar irgendetwas nicht. Sie interessieren sich für andere Dinge als man selbst, stehen zusammen herum, kichern und tuscheln und sind auch sonst sonderbar. Und wenn man mal eins von ihnen mag, zum Beispiel Piroschka, bricht unversehens die Kommunikation zusammen: »Je näher ich Piroschka kam, desto öfter sah sie zu mir rüber.« Schließlich fragt sie den insgeheim verliebten Martin, ob er ihr nicht einmal seine selbst geschriebenen Gedichte zeigen wolle. Das hätte sie besser nicht tun sollen. »In meinem Zimmer zermarterte ich mir das Gehirn, was ich Piroschka genau geantwortet hatte.« Die Liebe ist eine Himmelsmacht.
Aus der Perspektive des kleinen Buben erzählt uns Martin Schlosser die Chronik seiner Kindheit, die von den sechziger bis in die siebziger Jahre reicht, und von den vielen bis heute unvergesslichen Tragödien dieser Zeit: »Zu meinem Geburtstag wollte ich Tom Sawyer und Huckleberry Finn einladen, aber Mama sagte, die seien schon viel älter als im Fernsehen und außerdem Ausländer. Die könnten gar kein Deutsch. (…) Ich knallte die Zimmertür hinter mir zu und heulte in den gelbroten, kratzigen Vorhangstoff.«
Überhaupt regieren die Eltern die Familie mit harter Hand. Vor allem dem umtriebigen kleinen Martin erteilen sie Abreibungen, Zimmerarrest, Hausarrest und Fernsehverbot. Derlei bleibt auch deshalb nicht aus, weil Martin ein aufgewecktes Kerlchen ist, das nach der Schule gerne die Provinzwelt erkundet, durch die Gegend schweift und auch mal Spielzeugautos klaut. Dabei wird er einmal vom Kaufhauspersonal erwischt: »Ich musste so heulen, dass ich nicht viel mitbekam, nur die Wörter Ladendiebstahl, Anzeige, Polizei und Eltern, und davon musste ich noch mehr heulen.« Meist aber ist der Kosmos der Kindheit aufregend und abenteuerlich.
Wer in der Bundesrepublik der sechziger Jahre geboren wurde und sich nicht mehr en détail an alles erinnern kann, woraus sich seinerzeit im Elternhaus der kindliche Alltag zusammensetzte, dem wird es hier noch einmal erzählt. Ihm wird bei der Lektüre alles, wirklich alles wieder in den Sinn kommen: das Plätzchenbacken vor den Weihnachtsfeiertagen, die geliebten Weihnachtsgeschenke (»Carrerabahn«) und die ungeliebten (der Frotteeschlafanzug von der Patentante), die man bekam, und der böse, ungezogene Junge, der einem im Sandkasten immer den Sand in die Augen warf, einen nie aufs Klettergerüst ließ oder sonst etwas äußerst Fieses mit einem machte. Man kennt das alles.
Der Kindheitsroman ist, was er in seinem Titel vorgibt zu sein, ein kleines, aufgeräumtes Archiv voller angehäuftem, wohl geordnetem Material, in dem man seine Kindheitserinnerungen wiederfinden kann: Weihnachtsfeste, Kindergeburtstage, Verwandtenbesuche, Schulzeit, allerlei Sinnsprüche und kleinbürgerliche Binsenweisheiten der Eltern, Abzählreime, Kinderliedverse, Fernsehserien, Comics, Werbeslogans und andere zeitgenössische Trivialkultur en masse.
Gerhard Henschel hat einen erstaunlich komischen Roman daraus gemacht. Man wird sich bei der Lektüre, milde lächelnd und von einem nostalgischen Gefühl ergriffen, zurücklehnen, sich darüber freuen, dass man dem Knaben, der hier erzählt, auf eine gewisse Art ähnelt und sich sagen: Ja, so war das. Damals, als ich klein war.
Gerhard Henschel: Kindheitsroman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2004, 496 S., 22,90 Euro