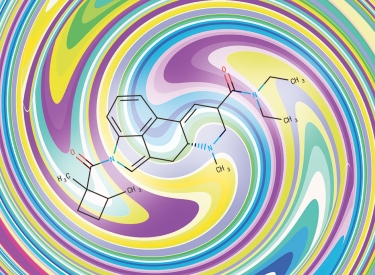Die Säulen der Herrschaft
Streiks unter gewerkschaftlicher Führung erinnern an den Ablauf von Parlamentswahlen. Die Beteiligten halten sich strikt an ein vorgegebenes Procedere, gegenseitiger Respekt und Fair Play werden groß geschrieben. Den Spitzenkandidaten entsprechen die Verhandlungsführer, dem Wahlergebnis der Tarifabschluss, und an Wahlurne wie Werkstor ist der Basis lediglich eine passive Rolle zugedacht.
Wie dem unterlegenen Spitzenkandidaten droht derzeit auch den IG-Metall-Funktionären Hasso Düvel und Jürgen Peters, den Anführern des Streiks in der ostdeutschen Metallindustrie für die 35-Stunden-Woche, ein Karriereknick. Denn der Streik endete im kompletten Desaster. Ohne auch nur das Geringste erreicht zu haben, brach die Gewerkschaft den Streik von fast 10 000 Lohnabhängigen nach vier Wochen einfach ab. Vergleichbares war zuletzt 1954 in Bayern geschehen.
Bis weit in die Gewerkschaften hinein heißt es, mit der 35-Stunden-Woche habe die IG Metall auf einen Anachronismus gesetzt. Also erscheint der nun ausgebrochene Konflikt in der Gewerkschaft als Richtungsstreit zwischen Hardlinern und Reformern, zwischen »Traditionalisten« und »Modernisierern«. Ob Peters wie geplant im Herbst den IG Metall-Vorsitzenden Klaus Zwickel beerben darf, gilt als Weichenstellung von großer politischer Tragweite.
Sicherlich bildet die Verkürzung des Arbeitstages eine zentrale Forderung der Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert, und auch der jüngste Streik in der ostdeutschen Metallindustrie war Ausdruck des Verlangens, so wenig Lebenszeit wie möglich in der Fabrik zu vergeuden. Dennoch ist Arbeitszeitverkürzung nicht zwangsläufig das klassenkämpferische Projekt, zu dem es in den vergangenen Wochen stilisiert wurde. In den letzten Jahren ging sie immer öfter mit betrieblichen Umstrukturierungen im Sinne der Unternehmen einher. Das radikalste Modell stammte aus den Schubladen des Managements selbst: die Viertagewoche bei VW in Wolfsburg, die unter konstruktiver Mitarbeit der Gewerkschaften zu einer enormen Flexibilisierung der Belegschaften führte und die Produktivität in ungeahnte Höhen trieb.
Auf einen solchen Deal liefen auch die Vorschläge der IG Metall im gerade gescheiterten Streik hinaus, die einen flexiblen »Arbeitszeitkorridor« zwischen 35 und 40 Stunden und die allmähliche Reduzierung der Arbeitszeit »entsprechend der Produktivitätssteigerung« vorsahen. Die gewerkschaftsnahe Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik argumentierte in einer Studie zur 35-Stunden-Woche im Osten, »dass die Produktivität infolge kürzerer Arbeitszeiten ansteigt«, weil unter anderem »die stündliche Leistungsfähigkeit der ArbeiterInnen bei einer geringeren wöchentlichen Belastung profitieren dürfte«. Ausgerechnet der Verhandlungsführer der Unternehmer, Roland Fischer, bemerkte dazu scheinheilig, aber treffend, »dass der Stress durch intensiveres Arbeiten ganz bestimmt nicht abgebaut werden kann«. Er wusste, wovon er sprach, denn nach jeder Arbeitszeitverkürzung ist die Verdichtung der Arbeit so sicher wie das Amen in der Kirche.
Einen neuen Flächentarifvertrag wird es nicht geben, weil die IG Metall zwar einer Verschiebung der Einführung der 35-Stunden-Woche auf den St. Nimmerleinstag ebenso zugestimmt hätte wie dem flexiblen »Arbeitszeitkorridor«, dabei aber auf einem Ausgleich für Mehrarbeit über die derzeit geltenden 38 Stunden hinaus bestand. Andernfalls wäre sogar eine Verlängerung der jetzigen Arbeitszeit möglich gewesen. Das reichte, um Peters und Düvel zu Saboteuren des Standorts zu erklären.
Die IG Metall hingegen vermutet hinter der Position der Unternehmer »keine ökonomischen, sondern ideologische Gründe« und wollte keinesfalls der Gegenseite weh tun. Auch der Ablauf des Arbeitskampfes zeugte nicht von einem Konfrontationskurs. Im brandenburgischen ZF-Werk brach die Gewerkschaftsführung schon vorzeitig den Streik ab, weil die Produktion in einigen Fabriken im Westen in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Die Reaktionen auf den Streik gewinnen vor diesem Hintergrund gespenstische Züge. »Fassungslos« zeigte sich der betroffene Unternehmerverband über das Treiben einer »aggressiven und von außen gesteuerten Minderheit«, die selbst vor »illegalen Mitteln« nicht zurückschreckte, »Schluss mit dem Klassenkampf!« forderte Lothar Späth im Handelsblatt. »Was durch die beispiellose Solidarbewegung während der Flutkatastrophe überwunden schien«, so Späth, »bricht durch die Gewerkschaftspolitik im Osten nun wieder auf.« In der Zeit waren unterdessen alle Sicherungen durchgebrannt: »Zum Krieg« habe sich der Streik entwickelt, der eine »Erscheinung des archaischen Rechts auf Selbsthilfe« sei. Verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichts, heißt es in der Zeit weiter, legitimierten den Staat, »diesen Schrecken zu bannen und die Rechtsgrundlagen des Streiks infrage zu stellen, auch wenn die Gewerkschaften aufheulen mögen«.
Die Nerven der Bourgeoisie liegen offenbar blank. Das weltweit bewunderte, sozial pazifizierte »Modell Deutschland« gründete nicht nur auf den Fundamenten des Nationalsozialismus, sondern hatte immer auch die Aussicht auf steigenden Massenwohlstand auf seiner Seite. Damit ist es definitiv vorbei. Gegenwärtig ist der umfassendste Angriff auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Lohnabhängigen in der Geschichte der Bundesrepublik zu beobachten. In dieser Situation erinnerte der Streik im Osten von Ferne an die Möglichkeit, die eigenen Lebensinteressen gegen eine Ordnung durchzufechten, die in Zukunft nichts als Verzicht bereithält. Die Gewerkschaftsführer weckten die Ängste des Bürgers vor der Aufkündigung des sozialen Friedens.
Das tatsächliche Verhalten der Gewerkschaften gibt zu diesen Befürchtungen keinen Anlass. Schon im Frühjahr hatte der DGB seinen halbherzigen Widerstand gegen die Agenda 2010 offiziell beendet. Und während in der IG Metall eine Personaldebatte ausbrach, präsentierten der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske und der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit strahlend den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Berlin, der eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich vorsieht. Für einige Beschäftigte bedeutet das Lohneinbußen von zehn Prozent. Etwas Besseres konnte dem Berliner Senat kaum passieren: Im öffentlichen Dienst wird wie geplant gespart, ohne dass der soziale Frieden durch Kündigungen zu sehr strapaziert würde.
Verändert hat sich nicht der DGB, sondern die wirtschaftliche Lage, von der er auf Gedeih und Verderb abhängt. Die Gemeinwohlverpflichtung der Gewerkschaften und ihr Verzicht auf jedes Programm zur Überwindung der bestehenden Produktionsweise führen zwingend in die sozialpartnerschaftliche Beteiligung am Krisenmanagement.
Im Zweifelsfall haben sich die deutschen Gewerkschaften immer als Säulen der Herrschaft bewährt. Mit der Anerkennung der Tarifautonomie bedankte sich der Staat 1918 für die gewerkschaftliche Politik des Burgfriedens während des Ersten Weltkrieges und lud zum Klassenbündnis der bürgerlichen Demokratie ein, die gegen radikale Sozialisten und die Rätebewegung erst noch zu sichern war. Eine sozialrevolutionäre Tendenz, die gewerkschaftlich zu kanalisieren wäre, ist heute nirgends in Sicht. Trotzdem stellte Gerhard Schröder nach dem Streikdebakel fest: »Wer in dieser Situation meint, man könne sozusagen zum entscheidenden Schlag ausholen, der vergeht sich auch an der Volkswirtschaft, die auf starke, aber auch kompromissbereite Gewerkschaften angewiesen ist.«


 Ein brauner Geburtstag in Brandenburg
Ein brauner Geburtstag in Brandenburg