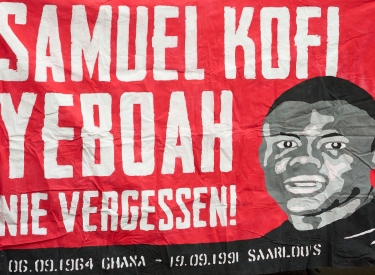Sprichst du deutsch?
Woher kommst du? Bist du illegal? Sprichst du deutsch? Wie ist das Leben bei euch in Afrika? – Die Fragen, die Schwarzen in Deutschland täglich gestellt werden, sind nervend und demütigend. Gaffende Blicke, Bemerkungen, die den Schwarzen eine Exotik zuschreiben, und handfeste Ausgrenzung zählen bis heute zum Repertoire der Mehrheitsgesellschaft. Ständig sichtbar zu sein und sich wehren zu müssen, sind Themen, die sich durch viele autobiographische Berichte schwarzer Menschen ziehen.
Der gegen AfrikanerInnen und schwarze Deutsche gerichtete Rassismus geht unter anderem auf die Verdrängung der Migrations- und Kolonialgeschichte zurück. Deshalb beschäftigte sich eine Tagung in Köln vom 13. bis 15. Juni mit der Geschichte und Gegenwart von AfrikanerInnen in Deutschland und mit schwarzen Deutschen. Der Verein Kopfwelten, der Kölner Appell gegen Rassismus und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) hatten dazu ins El-De-Haus eingeladen.
Am Tagungsort war bis Anfang des Jahres die Ausstellung »Besondere Kennzeichen: Neger. Schwarze im Nationalsozialismus« zu sehen. Die ISD hatte nicht nur den reißerischen Titel kritisiert, sondern auch, dass in der Ausstellung Schwarze einmal mehr an den Rand der Gesellschaft gestellt würden. Da die Ausstellungsmacher unter der Leitung des Historikers Peter Martin das rassistische Propagandamaterial aus der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus in den Vordergrund stellten, hatten es die Besucher schwer, etwas über die damaligen Lebensrealitäten von Schwarzen und ihre Überlebensstrategien zu erfahren. Stattdessen dominierten die Täterperspektive und die Geschichte des Denkens und Redens über Schwarze in Deutschland.
Obwohl Rassismus in vielen Ländern verbreitet ist, gibt es Besonderheiten im deutschen Diskurs, da hier das Verständnis von Nationalität auf einer Rassenkonstruktion gründet. Auf der Tagung zeigt die Historikerin Fatima El-Tayeb, dass die Kolonialdebatten im Deutschen Reichstag, insbesondere auch die Diskussion über die so genannten Mischehen für die Konstruktion der »weißen Rasse« und dessen, was »echte Deutsche« ausmacht, äußerst bedeutsam waren. In jenen Jahren zu Beginn des Nationalsozialismus und davor wurden politische, juristische und intellektuelle Kriterien für die spätere »Rassenordnung« entwickelt. Schließlich stellte 1937 ein deutscher Beamter, der einem in Berlin geborenen Schwarzen den Pass nicht verlängerte, kategorisch fest: »Es gibt keine schwarzen Deutschen.«
In der Bundesrepublik besteht die aus nationalgeschichtlichen Gründen absolute Unvereinbarkeit von Deutsch-Sein und Schwarz-Sein weiter, zwar nicht mehr per Gesetz, wohl aber in den Köpfen und in der Praxis der Behörden.
Im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich leugnete Deutschland stets die Einwanderung aus seinen ehemaligen Kolonien und anderen Ländern. »Mit ihrer Entstehung Mitte der achtziger Jahre traf die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland auf gleich zwei Lebenslügen der Bundesrepublik. Eine lautete: Deutschland ist kein Einwanderungsland. Die andere: Es gibt keinen Rassismus in Deutschland«, sagt Sascha Zinflou, der Sprecher der ISD in Nordrhein-Westfalen. Die rassenideologische Begründung, warum Schwarze keine Deutschen sein könnten, wich einer Erklärung, die auf Auslassungen in der Geschichtsschreibung fußt, nämlich darauf, dass in Deutschland zu keiner Zeit eine relevante schwarze Minderheit gelebt habe.
Deshalb setzte sich die in den achtziger Jahren aufkommende schwarze Bewegung in Westdeutschland, die stärker als in anderen Ländern von Feministinnen geprägt war, auch mit der deutschen Kolonial- und Migrationsgeschichte auseinander. Weiße Wissenschaftler haben mittlerweile das Thema ebenfalls aufgegriffen. In Köln offenbarte sich aber einmal mehr die Gratwanderung, auf der sich diese historische und gegenwartsbezogene Forschung bewegt. So beschäftigte sich Christian Koller mit der Situation afrikanischer Besatzungssoldaten an Rhein und Ruhr in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Er sprach detailliert über die deutsche Propaganda, welche die schwarzen Soldaten innerhalb der französischen Truppen als »schwarze Schmach« bezeichnete und sie als Wilde und Vergewaltiger halluzinierte. Nicht im Blick hatte er dagegen die Reaktionen der Schwarzen auf den rassistischen Diskurs in Deutschland und die einsetzende Straßengewalt gegen sie.
Nicht erneut mit gut gemeinter Wissenschaft Schwarze zu stereotypisieren oder zu marginalisieren – das hat weniger mit dem Farbpigmentanteil in der Haut zu tun, sondern mit der Reflexion über den weißen Blick. Der Forschungsbericht von Carmen Humboldt über die »afrikanische Diaspora« in Deutschland, in dem davon die Rede ist, dass sich AfrikanerInnen in Afroshops treffen und sich in ihren Kneipen zu Hause fühlen und dort ihre Traditionen pflegen können, sagt mehr über die kulturalistischen und homogenisierenden Bilder der Forscherin aus als über die Lebensrealität der EinwandererInnen.
Venant Adoville von der Flüchtlingsselbstorganisation The Voice schildert die Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt, die Polizeigewalt und die Gegenwehr von MigrantInnen. »Einige versuchen, sich politisch zu organisieren, um nicht länger das hiesige Publikum unterhalten zu müssen, indem sie auf der Djembe trommeln«, sagt Adoville. Gleichzeitig kritisiert er, dass viele AfrikanerInnen sich nur mit Menschen aus den gleichen Herkunftsländern organisieren. »Schon unsere Urgroßeltern, Großeltern und Eltern mussten Widerstand leisten«, sagt der Journalist, aber in Deutschland fehle es dazu an Austausch. Auch gebe es kaum Kontinuität in den Organisationsformen und Gegenwehrstrategien.
Für den ISD-Sprecher Sascha Zinflou sind die Rahmenbedingungen einer schwarzen Bewegung eng verknüpft mit dem Migrationsregime. In der Gleichzeitigkeit der Debatten um das Asylrecht und die angestrebte Einwanderung von Fachkräften sieht er eine Modernisierung des Rassismus: »Wir werden es mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der für Schwarze die individuelle Gefahr, Ziel von Rassismus zu werden, unter anderem als Folge der Asyldebatte von 1993 auf hohem Niveau stagniert. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich ein Antidiskriminierungsgesetz geben, das die Möglichkeit der rechtlichen Gegenwehr eröffnet.« Dass sich auch Schwarze in Erwünschte und nicht Erwünschte unterteilen lassen, befürchtet er nicht, da er der Funktionsweise des Rassismus vertraue. Der BGS-Beamte, der auf Bahnhöfen und in Zügen auf Menschenjagd gehe, werde dies nach undifferenzierten Bildern tun, egal wie differenziert das migrationspolitische Regime auch sei.



 Mit gelöster Bremse
Mit gelöster Bremse