Hilf und herrsche
Der Glaube an die Heilsversprechen der Biologie feiert seit geraumer Zeit sein weltweites Comeback. So auch in Berlin, wo vom 1. bis 6. Juli im ICC der 7. Weltkongress der Biologischen Psychiatrie tagte. Während hier eine Verbindung von Biologie und Psychiatrie durch Genetik forciert wurde, fand gleichzeitig die kritische Gegenveranstaltung »Freedom of Thought« in der Urania statt, die sich in zwei Teile gliederte. Das Symposium »Geist gegen Gene« stellte sich die Frage nach der Produktion von Krankheiten und Behinderungen durch ihre gentechnologische Imagination. Parallel dazu setzte sich das Russell-Tribunal mit dem Herrschaftscharakter der Psychiatrie und der Entrechtung der PatientInnen auseinander.
Eigentlich hatte der Kongress in der FU Berlin statt finden sollen. Die Direktorin der psychiatrischen Klinik der FU Berlin, Isabella Heuser, hatte sich jedoch gegen die Veranstaltung ausgesprochen. In einem Schreiben an das Präsidium der FU warnte sie vor dem Symposium und trug damit wohl zum Verbot, die Räume der FU zu nutzen, bei. »In einer Zeit«, schreibt sie, »in der die Psychiatrie auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau rasch weitere Fortschritte in der Erkennung und Heilung psychischer Erkrankungen macht, ist diese in finsterer, anti-psychiatrischer Ideologie verhaftete Veranstaltung nicht nur schädigend für das Ansehen der Freien Universität als eine auf hohen Standard bedachte Universität, sondern auch für eine neurowissenschaftliche moderne Psychiatrie.«
Um eine Kritik am ungebrochenen Glauben an die Wissenschaft, wie er von der Klinikdirektorin demonstriert wurde, sollte es auf dem Kongress gehen. Beide Symposien nahmen die Verletzung von (Menschen-) Rechten zum Ausgangspunkt ihrer Kritik. Am Russell-Tribunal zeigt sich, wie problematisch es ist, die Psychiatrie mit Hilfe der Kategorie der Menschenrechte anzugreifen.
Vorbild für das nach Bertrand Russell benannte Tribunal sind die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und deren Anklage der »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Am Beginn dieser zur Institution gewordenen Veranstaltungsreihe steht die Untersuchung der im Vietnamkrieg begangenen Verbrechen. Auf der Bühne des symbolischen Gerichts stehen Ankläger und Zeugen vor einer Jury, die auf dem Berliner Tribunal mit Wolf-Dieter Narr, Kate Milett, Paulo Coelho und anderen Prominenten hochkarätig besetzt war.
Russell beschrieb die Aufgabe des Tribunals als die Aufdeckung von Unrecht: »Wir müssen ein Urteil darüber fällen, was wir für wahr halten. (...) Unser Mandat ist es zu entdecken und alles zu sagen. Meine Überzeugung ist, dass kein größerer Beitrag geleistet werden kann als die Äußerung der Wahrheit, wie sie aus einer intensiven und unnachgiebigen Befragung entspringt.« Dass die zuweilen inquisitorische Wahrheitssuche an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei geht, gehört zu den unguten Traditionen des Tribunals, zu dessen Jurymitgliedern einst auch Jean-Paul Sartre und Michel Foucault gehörten.
In Berlin konnte man sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass aus den Zeugen Angeklagte wurden. Dies mindert nicht die eigentliche Leistung des Tribunals, nämlich den Zeugen Gelegenheit zu geben, die erlittene Gewalt zur Sprache zu bringen, verweist aber auf die Schwierigkeit, ausgehend von einer juristischen Konstruktion das Problem der Psychiatrie angemessen zu fassen.
Die Psychiatrie erfüllt seit jeher eine Doppelfunktion, in ihr verbündet sich der staatlich-rechtliche Machtkomplex zur Erfassung abweichenden Verhaltens mit dem Versuch, ein angemessenes Hilfsprogramm zu unterbreiten. Es ist genau dieser Zusammenhang, der Therapie in der Psychiatrie notwendig zur Strafe werden lässt, wie die Kulturtheoretikerin Gerburg Treusch-Dieter hervorhob. Die Fusion von Hilfe und Herrschaft ist der Psychiatrie also notwendig immanent. Eine Kritik, die sich an der psychiatrischen Zwangsbehandlung und der Verletzung von Grundrechten orientiert, verkennt jedoch, dass die Institution auch die Hilfefunktion zu erfüllen hat, und läuft Gefahr, an dem von der Psychiatrie vorgetragenen Argument zu scheitern, wonach man den Zwang bei solchen Hilfestellungen eben in Kauf nehmen müsse. Auf der anderen Seite kann die Leugnung der Hilfefunktion der Psychiatrie auch zu einer Verhöhnung der Betroffenen führen, die mit ihrem Leid alleine gelassen werden.
So führte die richtige Kritik, dass psychische Krankheit ein Konstrukt sei, den Hauptankläger des Tribunals, Thomas Szasz, in seinem Buch »Grausames Mitleid« (1997) zu einer neoliberalen Konzeption, die die Psychiatrie-Betroffenen als faule und kriminelle Parasiten, die sich hinter der »Krankheit« tarnen, diffamiert. Dem gegenüber gilt es jedoch gerade aufzuzeigen, dass durch die Verquickung von Hilfe und Herrschaft der Auftrag zur Hilfe gar nicht wahrgenommen werden kann, wie dies auch in den Aussagen der Zeugen deutlich wurde. Wenn Herrschaft und Psychiatrie zusammengehören, müsste vom Standpunkt einer menschenrechtlichen Argumentation also nicht nur die Abschaffung der Psychiatrie, sondern zugleich auch die Schaffung nicht-psychiatrischer Angebote gefordert werden.
Der Zusammenhang von Psychiatrie und Gewalt war auch Thema des zweiten Symposiums »Geist gegen Gene«. Stimmt es, wie die Biologische Psychiatrie suggeriert, dass die so genannten Geisteskrankheiten von den Genen ablesbar sind? Welche Erkenntnis bringt die vermeintliche Entschlüsselung der menschlichen Gene? Kann man tatsächlich lesen, was in den Genen steht? Dieser Vorstellung widersprach die Genetikerin Silja Salerski in ihrem Vortrag. Sie betonte, dass das Gen nie als Träger von Information entdeckt worden sei. Eine genetische Diagnose sei keine Analyse, die von einem Gendefekt auf eine Krankheit schließen lässt. Vielmehr wird, ausgehend vom Stammbaum und der Erzählung der PatientIn, eine Erkrankungswahrscheinlichkeit errechnet, die daraufhin einer genetischen Abweichung zugeordnet und als durch diese verursacht deklariert wird. Diese Art von Diagnostik erklärt die Person zu einem Risikoträger, der sein »persönliches« Risiko selbst zu verwalten hat und gleichzeitig Anlass für präventive Eingriffe und versicherungstechnische Diskriminierungen bietet.
Es sind jedoch nicht nur die direkten repressiven Eingriffe, die die Annahmen der Genetik zu einer Gefahr für die persönliche Integrität werden lassen. Mit den Effekten, die der Diskurs produziert, beschäftigte sich der Vortrag von Andreas Lösch. Die genetische Rasterfahndung funktioniert als Selbst-Technologie. Inwieweit setzt dies aber eine self-fulfilling prophecy in Gang? Mit dieser Frage ist eine Dimension angesprochen, die über die bloße Zurückweisung der Heilsversprechen der Genetik als Phantasma hinausgeht. Die eigentliche Wirkmächtigkeit dieser Technologie bestünde also darin, dass sie die idiosynkratischen Reaktionen der Individuen auf die Technologie zur Produktion neuer Subjektivitätsformen benutzt. So konnte Andreas Lösch aufzeigen, wie die Ideologie der Biotechnik den Menschen eine »Selbst-Eugenisierung« der eigenen »Humanressourcen« abverlangt.
Damit wird die Idee, den Geist gegen die Gene zu wenden, wie sie im Titel des Symposiums anklingt, selbst problematisch. Der Geist ist eben keine von der Technologie und ihrer Ideologie unabhängige Instanz und Gegenmacht. Dass diese scheinbar fatalistische Paradoxie von dem Kongress »Freedom of Thought« als ein offenes Problem erkannt wurde, zeugt von der hierbei angebrachten Vorsicht, die sich die Bio-Technologen offenbar nicht mehr zu leisten wagen.
Viola Balz und Roman Janda sind Mitglieder des Vereins zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. und Mitarbeiter des Berliner Weglaufhauses



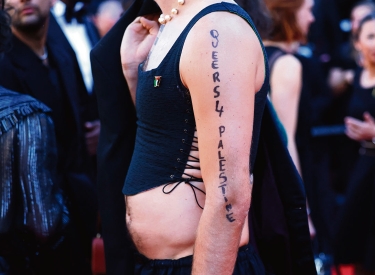
 Das queere Stockholm-Syndrom
Das queere Stockholm-Syndrom