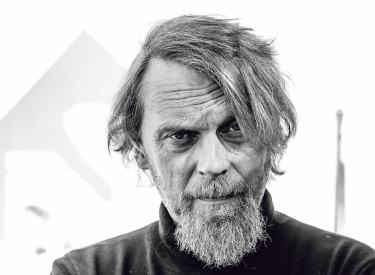Religion vom Reißbrett
Vielleicht müssen Religionsstifter im Zwielicht verschwinden, wenn der von ihnen entwickelte Glauben seine größten Erfolge feiert. Vielleicht ist es sonst keine Religion, nichts, an das man glauben kann, nichts Göttlich-Geheimnisvolles, das schon immer da war und nie verschwinden wird. Vielleicht müssen die Religionsstifter Platz machen für die Heiligen und die Propheten.
Als Haile Selassie 1967 zu einem Staatsbesuch nach Jamaika kommt, traut er sich auf jeden Fall nicht aus dem Flugzeug. Hunderttausend Menschen halten das Gelände besetzt, sitzen auf den Dächern der angrenzenden Gebäude, stehen neben der Rollbahn und drängeln sich, um ihn zu empfangen. Ihn, einen kleinen weißen Mann in einer Uniform, Kaiser von Äthiopien. Ihn, den Gottkönig des Rastafarianismus, den Erlöser, den Nachfahren König Salomons: Ras Tafari.
Eine halbe Stunde lang weigert er sich, das Flugzeug zu verlassen, kann schließlich von einem Rasta-Geistlichen überredet werden, steigt die Treppe hinunter, setzt sich in die wartende Limousine und fährt im Schritttempo durch die Menge. Stunden später wird er sich weigern, als Gott anerkannt zu werden, eine Aussage, die die Rastas als göttliche Bescheidenheit auslegen.
Einer ist nicht am Flughafen, als Selassie landet. Leonhard Howell, der Begründer der Rastareligion, ohne den es nie zu diesem Auflauf gekommen wäre. Aber die Religion braucht ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, sie funktioniert bereits ohne ihren Stifter. Howells Prophet fehlt allerdings auch am Flughafen. Bob Marley, ohne den man sich heute an den Staatsbesuch Selassies nur noch als merkwürdige Anekdote einer religiösen Massenhysterie in einem armen Karibikstaat erinnern würde. Marley arbeitet in Delaware in einem Chryslerwerk. Am Abend dieses Tages wird seine Frau Rita ihm einen Brief schreiben, um zu erzählen, sie werde zur Rastareligion übertreten, Selassie habe ihr am Flughafen in die Augen geblickt und sie habe seine linke Hand gesehen, die von einem Jesusmal gezeichnet sei.
Mit »Der erste Rasta« von Hélène Lee ist gerade die erste Biographie von Leonhard Howell erschienen. Nun gibt es genauso viele Geschichten des Reggae, wie Kulturwissenschaftler, Musikjournalisten oder Reisereporterinnen Zeitzeugen aufgetrieben haben. Seitdem ist viel Gras geraucht und viel Rum getrunken worden. Die Quellenlage ist unsicher, nichts Genaues weiß man. Von Howell gibt es lediglich drei Bilder, man weiß nicht einmal, wie viele Kinder er gezeugt hat, der größte Teil seines Lebens liegt im Dunkel. Gerade einmal das Geburtsdatum ist sicher.
Am 16. Juni 1898 kommt er zur Welt. Er ist der Sohn eines angesehenen Friedensrichters. Als Teenager verlässt er die Insel, geht nach Panama, wo gerade der Kanal gebaut wird, meldet sich zur britischen Armee, kehrt ihr wieder den Rücken, behauptet später, Europa und Asien bereist zu haben - kurz: Er ist einer jener zahllosen Schwarzen, die im Zuge der großen Migrationsbewegungen in den ersten zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts von einem Ort zum anderen gespült werden, je nachdem, wo es gerade Arbeit gibt. Er ist einer der vielen, die das kulturelle Kontinuum durchqueren, das der britische Kulturwissenschaftler Paul Gilroy als Black Atlantic bezeichnet hat.
Hélène Lee folgt ihm. Sie fährt nach Jamaika, sie stöbert in Harlem durch Archive und Antiquariate. Sie treibt Exemplare von Schriften auf, die in den Zwanzigern zu Dutzenden kursierten. Obskure reliöse Traktate, wie etwa die Holy Piby, die »schwarze Bibel«, Zeugnisse eines afro-amerikanischen Äthiopismus, Rezepte für Kräutermedizin, Dokumente über die Unia, die Universal Negro Improvement Association, die mit vier Millionen Mitgliedern die größte Organisation der Afro-Amerikaner war und die mit ihren berühmten Black Star Linern die amerikanischen Schwarzen nach Afrika zurückbringen wollte.
Die Unia war von Marcus Garvey begründet worden, und als er wegen Steuerschulden erst ins Gefängnis gesperrt und dann nach Jamaika abgeschoben wird, bricht die Organisation zusammen. Howell, der schon in Harlem mit Garvey befreundet gewesen war, glaubt jedoch, dass es vor allem das Fehlen einer zur Organisation passenden Kirche und Religion gewesen sein müsse, die zum Scheitern der Unia geführt habe. Und als auch er nach Jamaika zurückkehren muss, macht er sich daran, eine Religion für die Schwarzen in der Diaspora zu entwickeln.
Immer wieder sind es nur Fragmente, die Lee zu Tage fördert, und auch die Geschichten, die ihr erzählt werden, sind schon so oft kursiert, dass sie die merkwürdigen Schriftstücke aus fernen Zeiten nur fortschreiben. Und so belässt sie die Gültigkeit ihrer Recherchen in der Schwebe und versucht sich vorzustellen, wie es denn gewesen sein könnte, damals in den frühen Dreißigern, als Leonhard Howell in fröhlichem Synkretismus aus all diesen Versatzstücken die Rastareligion zusammenbaute.
Unorthodoxe Bibelexegese verbindet Howell mit einem kulturellem Pragmatismus: Die zentrale Stellung, die er etwa dem Marihuana-Rauchen zuweist, begründet er zwar mit der Bibel, Lee weist jedoch nach, dass er das Kiffen von der indischen Community Jamaikas übernimmt.
Im Zentrum der Rasta-Religion steht Haile Selassie, dessen prunkvolle Krönung 1930 in der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt hat. 72 Länder entsenden ihre Botschafter, und England überreicht ihm das Zepter, das die Briten Äthiopien einst geraubt hatten. Das Life-Magazine widmet der Krönung eine Sondernummer, die in den Schwarzen-Vierteln Amerikas in hoher Auflage kursiert. Diese Geste der Anerkennung durch die britische Krone nimmt Howell zum Anlass, für alle Rasta-Gläubigen zu dekretieren, sie seien nicht mehr der britischen Krone untertan, sondern Selassie, der schließlich von England anerkannt sei. Nicht zuletzt um sich auf dem diplomatischen Parkett zu legitimieren,hatte sich Selassie als Nachfahre König Salomons inszeniert, was Howell wiederum nutzt, um der Rasta-Religion eine Vergangenheit zu geben.
Jamaika ist eine britische Kolonie. Howell wird ins Gefängnis geworfen, kommt wieder frei, muss in die Psychiatrie und erwirbt schließlich das Pinnacle, ein viele Hektar großes Grundstück, wohin er sich mit seiner Gemeinde zurückzieht. Ein Gelände, wo Howell - der Gong - über mehrere Tausend Rastas herrscht, die vom Anbau und Verkauf von Marihuana leben - Ganja, das heilige Kraut, das die Rastas zum Sakrament erheben.
Doch genau dies wird dem Pinnacle und damit auch Howell zum Verhängnis. Nachdem er jahrelang geschickt zwischen den beiden Machtblöcken des Landes hin- und herlavieren konnte und der Marihuana-Anbau gegen Gewinnbeteiligung geduldet wurde, gerät er 1954 zwischen die Fronten. In einer überraschenden Polizeiaktion wird das Pinnacle geräumt und die Rastas müssen in die Gettos von Kingston umziehen. Von hier an verliert sich Howells Spur.
Allerdings führt erst die Vertreibung aus dem Paradies dazu, dass die Rastareligion so wirksam wird, wie sie heute ist, wo in jeder westdeutschen Fußgängerzone Gymnasiasten Rastalocken tragen und kiffen. Denn in Kingston verbindet sich die Musik der Rastas mit dem Sound der Straße, dem US-amerikanischen Rhythm'n'Blues. Daraus entsteht Ska.
Hélène Lee: Der erste Rasta. Aus dem Französischen von Angelika Inhoffen; Hannibal Verlag, Höfen 2000, 328 S., 38 Mark

 Zwischen Tatsache und Fiktion
Zwischen Tatsache und Fiktion