Weiter freies Fluten
Für alle, die wenig Steuern zahlen wollen, ist es ein Paradies. In Luxemburg blüht nicht nur der Benzin-Tourismus wie nie zuvor, auch Butterfahrten inklusive billigem Alkohol- und Zigaretten-Einkauf sind weiterhin ein Renner. Vor allem aber ist der kleinste EU-Staat bei jenen Reisenden beliebt, die mit einem Aktenkoffer in der Hand und nervösem Blick eins der über 200 verschiedenen Bankinstitute betreten. Drinnen werden kleine Coupons über die Theke geschoben und Scheine entgegengenommen. Doch mit dieser steuerfreien Art, Geld zu verdienen, soll endlich Schluss sein. Dies fordern seit langem einige EU-Staaten.
Das Thema bestimmte vergangene Woche auch den EU-Gipfel im portugiesischen Feira. In letzter Minute konnte dort eine Art Einigung im langjährigen Steuerstreit erzielt werden. Eine Einigung, die den Steuerstreit in der EU allerdings nicht beenden wird. Der Feira-Plan sieht so aus: In der ersten Phase können die 15 EU-Staaten für die maximale Dauer von sieben Jahren wählen, ob sie Informationen über Zinserträge von »Steuer-Ausländern« an die zuständigen Finanzämter weiterleiten oder ob sie eine Quellensteuer auf das angelegte Kapital erheben. Ein »angemessener« Teil davon soll dem Wohnsitzstaat des Anlegers überwiesen werden.
In der zweiten Phase soll dann endgültig Schluss gemacht werden mit dem »top secret« in der Wirtschaftswelt: Alle EU-Staaten müssen das Bankgeheimnis lüften und auf das System des Informationsaustausches umsteigen. Ohne sich dabei allerdings auf eine harmonisierte Kapitalbesteuerung festzulegen. Die genauen Details dieser EU-Richtlinie müssen in den nächsten zwei Jahren festgelegt werden.
Wie unterschiedlich die Interpretationen des verwirrenden Textes sind, zeigt das Beispiel Österreich. Bis zuletzt hatte sich das Land, in dem das Bankgeheimnis in der Verfassung verankert ist, gegen den Kompromiss gestellt. Die Steuerharmonisierung, so die Hoffnung, könnte dazu dienen, die EU-Partner in der Frage der Sanktionen weich zu klopfen. Dass hinter den Kulissen über eine mögliche Aufhebung der Sanktionen verhandelt wurde, wiesen die 14 Staats- und Regierungschefs nach dem Gipfel weit von sich.
Dennoch lenkte Österreich ein. Ohne allzu große Verluste, wie Bundeskanzler Wolfgang Schüssel meinte. Nach dem Gipfel erklärte er seine Sicht der Dinge: »Wir haben an unserer grundlegenden Position, das heißt an der Bewahrung des Bankgeheimnisses, festgehalten.«
Tatsächlich hatte er zumindest einen Teilerfolg erzielen können: In den Schlussfolgerungen des Gipfels steht im Anhang, dass Österreich »aus Verfassungsgründen« zur Zeit einer Aufhebung des Bankgeheimnisses nicht zustimmen könne. Zudem wird vorsorglich erwähnt, dass das Land für die Menschen mit Wohnsitz in Österreich sowohl die Quellensteuer als auch das Bankgeheimnis aufrecht erhalten kann. Sein Land habe einen großen Beitrag bei der Suche nach einem Kompromiss geleistet, betonte Schüssel stolz. Und fügte im Hinblick auf die Sanktionen hinzu: »Jetzt sind die anderen am Zug.«
Der Steuerstreit in der EU ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Als die EU-Staaten 1988 im Hinblick auf den gemeinsamen Markt beschlossen, jede Kapital-Kontrolle aufzuheben, hatten sie ein Problem übersehen: Die EU-Mitglieder besteuern jeweils das Kapitaleinkommen ihrer eigenen Staatsbürger, nicht jedoch das der »non-residents«. Steuer-Hinterzieher konnten so ihr Geld einfach im EU-Ausland investierten. Nach jahrelangen aussichtslosen Verhandlungen schlug der »Ecofin«, der Rat der 15 Wirtschafts- und Finanzminister, im Dezember 1997 ein System der Ko-Existenz vor: Die EU-Staaten sollten zwischen Quellensteuer oder Aufgabe des Bankgeheimnisses wählen.
Ohne uns, meinten jedoch die Briten und forderten, dass ausschließlich ein System des Informationsaustausches gelten sollte. Länder wie Luxemburg, Österreich, Belgien und Griechenland halten ihrerseits weiterhin am Bankgeheimnis fest.
Eine Kapitalflucht aus Europa müsse unbedingt verhindert werden, rechtfertigte Luxemburgs Finanzminister Luc Frieden die Haltung seiner Regierung. Schließlich gebe es auch genügend andere Möglichkeiten, um Steuern zu hinterziehen. »Um schmutziges Geld anzuziehen«, findet auch Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker, »braucht man kein Bankgeheimnis«.
Unternehmen finden genug »legale« Wege, um Geld zwischen mehreren internationalen Anlege-Adressen weißzuwaschen. Gewinnsteuer können sie umgehen, indem sie Tochtergesellschaften in EU-Staaten mit niedriger Einkommensteuer gründen. Das Bankgeheimnis betrifft daher vor allem Privatpersonen. Rund 800 Milliarden Mark sollen allein die Deutschen in den letzten Jahren außer Landes geschafft haben, um dem Finanzamt zu entgehen.
Sie werden aber auch künftig mit einer EU ohne Bankgeheimnis noch genügend Steueroasen finden. Denn Nicht-EU-Länder, die keine Quellensteuer erheben und die das Bankgeheimnis hüten, gibt es genug. Ein Grund, warum auch in der EU alles beim Alten bleiben könnte. Im Kompromiss von Feira wurde festgehalten, dass die Kommission sich in Drittstaaten wie den USA, der Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra und San Marino dafür einsetzen soll, dass »gleichwertige« Maßnahmen wie in der EU durchgeführt werden. Doch mit welchen Argumenten die Kommission hier auftrumpfen soll, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.
Erst wenn die Verhandlungspartner »hinreichende Zusicherungen« über die Anwendung der Maßnahmen gegeben haben, wird der Ministerrat bis Ende 2002 über die Richtlinie beschließen. »Wir werden uns dem System des Informationsaustausches nicht anschließen, solange die betroffenen Drittländer nicht nachziehen«, betonte Jean-Claude Juncker in Feira. Nicht nur deshalb konnte er beruhigt heimfahren. Über die Höhe der Quellensteuer etwa wird in dem Feira-Plan kein Wort verloren. Lediglich zehn Staaten meinten, die Steuer sollte zwischen 20 und 25 Prozent betragen.
Zudem ist die in Österreich erforderliche Verfassungsänderung alles andere als eine beschlossene Sache: Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, das heißt eine Zustimmung der österreichischen Sozialdemokraten. Und »wenn Österreich bis 2002 sein Bankgeheimnis nicht aufgibt«, erklärte Jean-Claude Juncker, »wird auch Luxemburg dem Steuerpaket nicht zustimmen«.

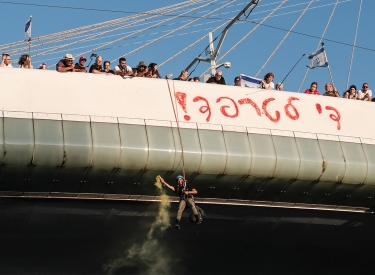
 Planlos in Doha
Planlos in Doha
